Petra Bartoli y Eckert: Reden wir übers Sterben
Was ich auf dem Münchner Jakobsweg über Leben und Tod gelernt habe
München ; Volk Verlag ; 2024 ; 168 Seiten ; ISBN: 978-3-86222-507-1

Die Medizin hat es geschafft, das Leben immer mehr zu verlängern, jedoch irgendwann werden wir alle am Ende unseres Weges angekommen sein. Der Blick auf das lichtdurchflutete Cover mit den Bergen im Hintergrund, weckt Hoffnung und Vertrauen und lädt ein, mehr darüber zu erfahren.
Der erste Satz der Verfasserin, im Innenteil des Klappumschlages stimmt nachdenklich: „Mir war klar, dass das Leben endlich ist, dass es im nächsten Moment vorbei sein könnte. Und dass ich mich nicht so wichtig nehmen sollte“. Angetrieben von dieser Erkenntnis machte sich Petra Bartoli y Eckert auf einen langen Weg, gefüllt mit einzigartigen Begegnungen und Gesprächen. Durch den Gedanken „Das ist mein Weg, ich werde ihn gehen“, schöpfte die Autorin die Kraft, für die zum Teil äußerst beschwerliche Strecke auf dem Münchner Jakobs-Weg. Bereits die ersten Zeilen im Buch gehen unter die Haut und wecken die ersten „Aha-Momente“. Die persönliche Trauererfahrung der Autorin berührt tief.
Auf dem Weg durfte sie erfahren, dass Heiterkeit und Freude kein wirklicher Widerspruch zu Tod und Trauer sind. Im Gegenteil. Am Ende wird einem klar, dass man selbst die beste Besetzung im eigenen Lebensfilm ist und war. Der Weg ist geprägt ist durch Begegnungen und den Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen und ihren bewegenden und äußerst berührenden, überwältigenden, zum Teil sehr traurigen Geschichten und Biografien. Die Autorin traf sich mit, von Ihr zum Teil bereits im Vorfeld sorgfältig ausgewählten Menschen: einer Trauerrednerin, einer Künstlerin für Erinnerungskunst, einem Freitodbegleiter, einer jungen Witwe, einer Bestatterin, einem Sargmaler, einer Friedhofsgärtnerin und dem Kabarettisten Gerhard Polt.
Aber gerade auch die zufälligen Begegnungen auf dem Weg mit Menschen machen die „Gesamtessenz“ des Werkes aus.
Welche Umstände, Tatsachen, Begegnungen, Begleitungen haben diesen Menschen mit den Themen Sterben, Tod und Trauer in Verbindung gebracht oder auch den Anstoß gegeben, sich beruflich in
diese Richtung neu zu orientieren? Das jeweilige Umfeld, Lebenssituationen, Erfahrungen, Beruf etc. der Befragten, schenken dem Leser eine Vielfalt an interessanten Einblicken, Perspektiven und
Meinungen. Der Spannungsbogen zieht sich durch alle Interviews im Buch. Lachen und Weinen liegen nahe beieinander. Manchmal spürt man die Enge und den Klos im Hals. Die Palette der Meinungen
bildet einen Schatzkiste voller Fundstücke, welche nicht abwechslungsreicher gefüllt sein könnte. All diese Menschen haben eines gemeinsam: Ihre Offenheit und eine gewisse Leichtigkeit, mit der
sie mit den Themen Tod und Trauer umgehen.
Trauern bedeutet Arbeit „Trauerarbeit“. Dabei Menschen und deren Erfahrungen zur Seite zu haben ist ein großer Schatz und jeder Trauernde ist so individuell, wie die Möglichkeiten des Beistandes. Die einzelnen Interviews sind so abwechslungsreich und so flüssig lesbar verfasst, dass an keiner Stelle des Buches Langeweile oder Eintönigkeit aufkommt. Im Gegenteil, man möchte die Literatur gar nicht aus der Hand legen, weil die einzelnen Biografien und die Betrachtungsweisen der Menschen so fesselnd und tiefgehend erzählt, verfasst und wiedergegeben sind. Interessante Überschriften umrahmen jede einzelne der Geschichten und laden Schritt für Schritt zum Weiterlesen ein.
Bitte vor dem Lesen Taschentücher fürs Lachen und Weinen bereit legen und viel Zeit einplanen. Man möchte das Buch am Liebsten nicht mehr aus der Hand legen.
✔ Fazit: Sterben und Trauer kann sehr farbenfroh begleitet werden. Trauern bedeutet Arbeit „Trauerarbeit“. Dabei Menschen und deren Erfahrungen zur Seite zu haben ist ein großer Schatz und jeder Trauernde ist so individuell, wie die Möglichkeiten des Beistandes. Dieses Buch ist als „Pflichtlektüre“ mehr als zu empfehlen. Der Autorin gebührt größter Respekt und allergrößter Dank, dass sie sich mit den Fragen rund um die brisanten Themen „Tod, Sterben und Trauer“ auf den Weg gemacht hat.
Jutta Kloth
★★★★★
5 von 5
© 2025 Jutta Kloth, Harald Kloth, Cover: Copyright © Volk Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Petra Bartoli y Eckert: Reden wir übers Sterben *Taschenbuch bei amazon.de
Ewig Dein
2023/2024
Regie: Johanna Moder
Judith (Julia Koschitz) führt ein selbstbestimmtes Single-Leben. Sie betreibt ein Geschäft für Kronleuchter. Im Supermarkt trifft sie auf Hannes (Manuel Rubey). Belanglose Sätze werden ausgetauscht. Hannes taucht überraschend in ihrem Geschäft auf. Er erreicht ein erstes Date, man ist sich sympathisch. Die junge Frau lässt sich auf den charmanten Mann ein. Judith ist begeistert von dem Mann, der sie wie auf Händen trägt. Der scheinbar perfekte Traummann. Immer tiefer taucht er in ihr Leben ein. Judiths Familie und Freunde sind begeistert von dem freundlichen, hilfsbereiten Mann.
Erst langsam realisiert Judith, Hannes starke Eifersucht und seine Eingriffe in ihr Leben. Auf einer Reise in Venedig eskaliert die Beziehung, als er sie völlig überfordert. Zudem geht es ihr gesundheitlich immer schlechter. Spontan flieht Judith aus dem Hotel. Sie fährt zurück nach Österreich und bricht jeden Kontakt zu Hannes ab. Seitens ihrer Familie herrscht über den Beziehungsbruch völliges Unverständnis. Einzig ihrer alter Freund Gerd (Stefan Rudolf) durchschaut die Machenschaften von Hannes. Dessen Stalken von Judith wirft die Frau psychisch und emotional völlig aus der Bahn. Sie wird medikamentenabhängig und landet in der Klinik. Doch Hannes plant bereits akribisch die Kontrolle über Judiths Leben zu erlangen ...
Das Subgenre des Psychothrillers setzt die Beziehung der Hauptprotagonisten in den Mittelpunkt. Dadurch spielt sich die Handlung oft im unmittelbaren und vermeintlich sicheren Wohnumfeld ab. In »Der Feind in meine Bett« (1991) ist Julia Roberts das Opfer. In »Fatale Begierde« (1992) wird Ray Liotta übergriffig und in »One Hour Photo« (2002) dringt Robin Williams in die Privatsphäre einer Familie ein.
»Ewig Dein« muß sich vor den großen Hollywoodfilmen nicht verstecken. Die beiden Hauptdarsteller spielen ihre Rollen sehr überzeugend. Die schauspielerische Zurückgenommenheit von Manuel Rubey verleiht seiner Figur enorme Intensität und Bedrohlichkeit. Aus den fesselnden 90 Minuten hätte man auch gut eine Miniserie machen können. Um z. B. der Familie, Mutter Edith (Barbara Auer) oder Bruder Ali (Marcel Mohab), mehr Tiefe zu geben.
»Ewig Dein« basiert auf dem gleichnamigen Roman (2012) des Österreichers Daniel Glattauer. Neben »Darum« (2008), »Die Wunderübung« (2018), »Geschenkt« (2018), »Gut gegen Nordwind« (2019) und »Die Liebe Geld« (2021) ist »Ewig Dein« bereits die sechste Verfilmung eines seiner Werke.
In der ▶ ZDF-Mediathek ist der Fernsehfilm bis März 2026 verfügbar. »Ewig Dein« ist nicht auf DVD oder Blu-ray erhältlich.
✔ Fazit: Ein hochspannender Psychothriller.
Harald Kloth
★★★★★
4/5 von 5
© 2025 Harald Kloth
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Daniel Glattauer: Ewig Dein *Kindle bei amazon.de
*Taschenbuch bei amazon.de
*Hardcover bei amazon.de
Christina Morina: Tausend Aufbrüche
Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren
München ; Siedler ; 2023 ; 400 Seiten ; ISBN 978-3-8275-0132-5

Wie sich der Weg in einen verstärkten Konservatismus in Deutschland schon seit Jahren, ja Jahrzehnten abzeichnete, weist Christina Morina in ihrem neuen, in der Analyse beeindruckenden Buch
»Tausend Aufbrüche - Die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren« nach.
Wie gut ist Deutschland nach 35 Jahren wirklich zusammengewachsen? Oder waren sich „Ossies“ und „Essies“ schon mal näher und divergieren nun seit einer Zeit wieder auseinander? Was hat das alles
mit der zunehmenden Popularität der AfD zu tun? Antworten darauf gibt Christina Morina, die geschichtswissenschaftlich untersucht, aufbereitet und darstellt, wie sich beginnend in den 1980er
Jahren in der DDR sowie der BRD über die Wiedervereinigung bis in die heutigen Tage Demokratieverständnis sowie Kulturgeschichte unterschiedlich oder auch verflochten entwickelt haben. Genauer
gesagt erklärt sie, was man vor der Wiedervereinigung unter Demokratie in Ost und West verstand und warum die nicht endgültig abgeschlossene Geschichte Ostdeutschlands Sympathiebekundungen und
einen Nährboden für rechtsextreme Ansichten bietet. Das Echo politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen vor und im Zuge der Wende, somit vor über 35 Jahren, werden also von ihr mit
aktuellen politischen Entwicklungen (Stichwort „Rechtsruck“) exzellent verbunden.
Christina Morina, im Zeitraum der Wiedervereinigung selbst erst 12 Jahre alt, ist Professorin für Allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität
Bielefeld. Sie habilitierte zu den Ursprüngen des Marxismus und beschäftigt sich, neben den Auswirkungen des Nationalsozialismus auch noch auf heute, gerade mit der Erinnerungsgeschichte des
einst geteilten und nun vereinigten Deutschlands.
Schwerpunkt des Buches ist dazulegen, ob und wenn ja wie sich die Vorstellungen der Bürger über die Rolle des Staates und dem Verständnis zu eigener Selbstverwirklichung in einer Demokratie über
die Jahre unter den sich veränderten außen- und innenpolitischen Entwicklungen angepasst haben. Dies macht Morina anhand eines immensen Fundus an Quellen, u.a. Schreiben an das Büro des
Bundespräsidenten, an Ministerien sowie der SED in der DDR, sogenannte Bittbriefe (eine Art Eingaben) an Erich Honecker, Konzeptpapieren, Flugblättern, Petitionen, Schreiben an die „gemeinsame
Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat“ und unzähligen weiteren Dokumenten in den jeweiligen Archiven. Anhand dessen analysiert sie die Vorstellungen und Erwartungen der Bürger an die
Demokratie, an den Staat für das eigene Tun basierend auf den jeweiligen Erfahrungen, nennen wir es ruhig Sozialisierungen, aus unterschiedlichen Staatssystemen kommend. Dabei betrachtet sie
gleichermaßen Quellen aus allen Bevölkerungsgruppen und -schichten und auch in Deutschland lebende Menschen mit Einwanderungshintergrund sind Teil der Untersuchung. Was bedeutete es also, vor
1989 in dem jeweiligen System in dieser politischen Ordnung gelebt zu haben, wie wurde diese empfunden und wie haben sich diese Empfindungen nach der Wiedervereinigung
verändert?
Morina zeigt anhand der Quellen dabei die unterschiedlichen Entwicklungen in Ost und West auf und kommentiert das entsprechend. Trotz Verzicht auf etwaige Grafiken, Tabellen und Abbildungen zu
der Flut an Informationen, macht sie das jederzeit verständlich. Wie der einzelne aber damit umgeht, überlässt sie den Leser, ist also individuell unterschiedlich. Am Ende appelliert sie auch an
die Politik, dass die gesellschaftlichen Grundlagen der SED-Diktatur auch 35 Jahre nach ihrem Ende immer noch nicht hinreichend aufgearbeitet sind.
Aus den eben dargestellten Quellen, die jeweils spezifisch für einen Anlass ausgewertet und analysiert wurden, z.B. zu der Frage nach der zukünftigen Hauptstadt, der sie sich wegen seiner
(Nach-)Wirkung besonderer Aufmerksamkeit widmet, werden die Ideale, Wünsche, ja Sehnsüchte der Bürger, gerade die des aktiv wirkenden Staatsbürgers, deutlich. Diese beinhalten sowohl Hoffnungen
wie auch Forderungen, die teils erfüllt wurden, aber auch zu Enttäuschungen führten. Morina stellt dar, wie sich diese Empfindungen für Demokratie jeweils im getrennten Deutschland unterschieden,
aber auch, wie sich diese heute noch zwischen den Bürgern in den Ost- und West-Bundesländern unterscheiden.
Wie groß waren nun die Differenzen hinsichtlich der Blickweisen der Bürger auf „ihren“ Staat? Für Morina war der „West-Bürger“ der Wahlbürger, Staatsbürger, Steuerbürger, also ganz im Sinne des
„alten Fritz“ (Friedrich der II. von Preußen) erster Diener des Staates. Damit war er der dem Staat dienende Bürger und damit gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft. Der Ost-Bürger dagegen
legte Wert auf eine egalitäre Gesellschaftsordnung, gleichmäßige Verteilung von Einkommen und Vermögen sowie Zugang zu Ressourcen. Eine identitäre Herrschaftsordnung, also aus Sicht des Bürgers
eine Art Untertanentradition, inklusive eines Ethnopluralismus war prägend. Ein Umstand, den heutzutage auch die Rechten immer wieder aufgreifen. Dies beinhaltet auch die aus der Wendezeit
bekannte „Demokratie der Straßenpraxis“, wie die Autorin das bezeichnet, also Demonstrationen gegen die Regierung, für ein bestimmtes Ziel aktiv eintreten. Im Vergleich wurde also für Morina in
der DDR der Staat als soziales (Gemein-)Wesen verstanden, während man im Westen den Staat eher als poltisch-rechtliche Ordnung wahrnahm. Diese beeinflusste natürlich das Bürgerselbstverständnis
als Bürger und Bürgerin.
Insgesamt war das soziale wie politische Engagement der DDR-Bevölkerung größer. Sie nahm im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz im Sinne des Grundsatzes des Artikels 21 (1) der Verfassung „Plane mit,
arbeite mit, regiere mit!“ in den diversen Gremien ihr Recht auf politische Teilhabe und Mitgestaltung vergleichsweise stärker wahr. Daraus, so die Autorin, entwickelte sich ein
Gemeinschaftsgefühl, ein Bekenntnis gerade zu den sozialen Idealen, während der Staat an sich und seine Institutionen jedoch abgelehnt wurden. Diese Mitwirkungsrechte in der DDR waren in der
Verfassung als moralischer Imperativ formuliert. Die Verantwortungsbereitschaft für die „sozialistische Heimat“ wurde gestärkt, um die jeweilige Lebensform und den Alltag im Sinne des Sozialismus
aktiv zu gestalten. Das bürgerliche „Mitregieren“ fand allerdings natürlich dort seine Grenzen, wo der Wille des Bürgers den eng gesteckten Rahmen des Regimes durchbrechen wollte. Trotzdem waren
diese Vorstellungen von aktiver Demokratie, die tägliche Auseinandersetzung über noch fehlende Komponenten zur eigenen Selbstverwirklichung letztendlich die Basis für die später entstehenden
Bürgerbewegungen. Dies kumulierte dann 1989 zunächst in dem Unmut über die Art und Weise des Umgangs mit der Vorbereitung, Verlauf und Nachbereitung der Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989, als
erstmalig unabhängige Bürger die Wahlen überwachten und Wahlmanipulationen, gesteuert durch das Ministerium für Staatssicherheit (MfS), nachwiesen. Dieser Unmut stimulierte weitere Bürgerrechts-
und Protestbewegungen, die schließlich am 7. Juni startenden Wahldemonstrationen führten zu den bekannt folgenreichsten Protesttraditionen in der Geschichte der DDR. Die Kommunalwahlen und seine
folgenden Reaktionen gelten heute als DAS Ereignis hin zu einer breiteren Demokratisierung und zum Ende der DDR.
Einen breiten Raum widmet Morina der Frage nach der Beliebtheit der AfD in den Neuen Bundesländern. Gegründet am 6. Februar 2013 ist die AfD nicht die Neue Rechte, sondern diese bestimmt vielmehr
die AfD. Mittlerweile ist die AfD eine zwar nicht bündnisfähige aber normale Partei, angetrieben durch Erfolge anderer rechter Parteien in Europa. Sehr sachlich und damit umso nachvollziehbarer,
aber auch mal pointiert und mit der notwendigen „Würze“, erklärt Morina die Psychologie und Vorgehensweise der AfD, um für ihre Ziele gerade in den neuen Bundesländern Zuspruch zu erhalten.
Durch eine Art historische Reflexion und eine Verknüpfung mit äußeren Einflüssen wie z.B. der Einwanderungsdebatte, vermittelt sie Verständnis für die vielerorts politische Spaltung. Während der
Westen mit den „wilden 68er“ sich einer liberalen und pluralen Gesellschaft öffnete, blieb der Osten an Normen, linke und rechte Grenzen seines Tuns und Handels gewöhnt, also quasi sozialisiert.
Dazu zählt auch eine mangelnde transparente Aufarbeitung der Verbrechen im Dritten Reich. Diese Kultur der Form der „Teilhabe in Grenzen“ erklärt auch die größere Affinität der Ostbürger zu
rechter Politik, also autoritären Führungsstil, Befürwortung eines Ethnopluralismus bei gleichzeitigem eingeschränkten Meinungspluralismus sowie der radikalisierten oder gar extremen rechten
Politik im Osten. Ein zumindest subtiles Misstrauen gegen die Verwaltung (korrupt!) sowie dem Parlament ist imminent.
1989 und die Folgejahre mit ihren Bürgerrechtsbewegungen waren wahrlich ein Aufbruch, das alles basierend auf einem „Hunger nach Demokratie“, das bestehende demokratische System der ehemaligen
BRD zu optimieren, auch auf die Bedürfnisse der Bürger in den neuen Bundesländern anzupassen. Doch nun ist in fast allen Ost-Bundesländern die anti-demokratische Partei AfD stärkste Kraft. Wie
konnte es dazu kommen? Der AfD gelang es, ostdeutsche Gefühls- und Gemengelage aufzunehmen und mit nationalkonservativen sowie rechtsradikalen Überzeugungen zu amalgamieren. Laut Autorin gibt es
in Anlehnung an den aus dem Fernsehen bekannten Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte drei Gründe: Erstens das raue Gesprächsklima zwischen Politik und Bürger, zweitens zunehmendes mangelndes
Vertrauen in die Politik und drittens Wahlergebnisse, die eine stabile Regierungsbildung, egal ob auf Bundes- oder Länderebene, sehr sehr schwierig gestalten.
Nach der Wende wäre die Möglichkeit gegeben gewesen, in einer Art Labor-Situation und mit Experimenten das Demokratieverständnis zu harmonisieren, z.B. der Wunsch nach mehr aktiver
Bürgerbeteiligung. Dieser Wunsch wurde aber leider nicht erfüllt, der westdeutsche Parlamentarismus siegte über die Bürgerbewegung und es kam eben zu keiner neuen Verfassung. Auch wenn bei den
Bürgern zunächst die Euphorie nach Währungseinheit und den Freiheitsrechten überwog, führte diese mittelfristig zu einer zunehmenden Abwendung von der „Politik der Mitte“ hin nach rechts bzw.
auch zu der viel beschworenen Politikverdrossenheit.
Morina schreibt überwiegend ohne Parteinahme, ohne größere Emotionen, sondern vielmehr nüchtern, sehr objektiv und vor allem wenig provokativ mit dem Fokus auf den normalen Bürger. Trotzdem
taucht man gerne in die Gedankenwelt seiner „Mitbürger“ sowie in die Analyse Morinas ein. Die Autorin selbst bezeichnet dies sehr treffend als „politische Kulturgeschichte von unten“. Das macht
ihre Aussagen authentisch und das Buch so besonders. Logisch nachvollziehbar erklärt sie den Ausgangspunkt und die Veränderungen des Demokratieverständnisses sowie der Rolle der Bürger in Ost-
und Westdeutschland vor und natürlich nach der Wiedervereinigung. Das Verständnis, Wahrnehmung, die wechselseitigen Relationen sowie den Wandel aber auch ihre Diskrepanzen über die Zeit von
Staat, Bürger und Demokratie werden also quasi „zwei- und einstaatlich“ in vergleichender Betrachtung in allen Facetten dargelegt.
Interessant ist, dass lange Zeit in den Führungsebenen von Parteien, dem Justizwesen und den Bundesregierungen inkl. aller Ministerien bei einem Bevölkerungsanteil von 16% ostdeutsche Bürger mit
25% überrepräsentiert waren. Dies, so Morina, eine unmittelbare Auswirkung und Beleg der „tausend Aufbrüche“, der Drang nach aktiverer Beteiligung an Demokratie. Für viele, die noch 1989
demonstriert haben, davor Briefe an das Regime geschrieben haten, wurde Politik zur Berufung, ja zum Beruf. Der mit der Wiedereinigung gewollte Aufprall zweier unterschiedlicher Sichtweisen von
und über Demokratie interließ bei den Bürgern im Osten Dellen, um bei dem Beispiel mit dem Aufprall zu bleiben. Heute liegt die Zufriedenheit mit der Form des demokratischen Systems Deutschlands
in den Neuen Bundesländern unter 20% und damit weit hinter der Akzeptanz im Westen. Für diese Identitäts- und Benachteiligungsgeschichte zwischen Ost und West, der Hinwendung zu rechten Parteien
gerade in den östlichen Bundesländern, gibt es laut Morina also nachvollziehbare Gründe. Auch die Diskrepanz zwischen dem, was das SED-Regime jahrzehntelang den Bürgern als das Richtige und Gute
„verkaufte“, was aber real passierte bzw. wie sich die Realität für die Menschen anfühlte, führte und führt noch teilweise zu Wut, aber vor allem zu Misstrauen und Widerstand gegenüber den
traditionellen Parteien und dem Staat. Man fühlt sich ausgegrenzt von der Demokratie und wendet sich den rechten Parteien zu. Dies aber, obwohl für den inneren Einigungsprozess in
sozialpolitischer Hinsicht die für die ehemaligen DDR-Bürger wichtigen Aspekte in den Bereichen Arbeit, Wohnung, Bildung sowie Sozialversicherung implementiert wurden.
Die Geschichte des Anspruchs der Bürger hinsichtlich Demokratie ist nun erzählt. Es ist nun Aufgabe der Politik daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen, z.B. mehr Bürgernähe im demokratischen
System zu vermitteln. Aber so lange stets Kompromisse geschlossen werden müssen, man sich auf das kurzfristige Geschäft konzentriert, um bei Wahlen möglichst gut abzuschneiden, man sich auf das
Machbare fokussiert, wird die Vision einer neuen Republik, die der Bürger mehr goutieren würde, nie realisiert werden können.
Auch wenn äußerlich, rechtlich und formal die beiden Deutschlands vereint wurden, tief in seinem Inneren war und ist es gespalten. Neben Emotionen und großen Errungenschaften im Zuge der
Wiedervereinigung kam es also, frei nach Theodor Fontane, zu „Irrungen, Wirrungen“, man muss sich diese nur eingestehen. Das ist ja etwas, was genau die Politik eben nicht macht. Die Wende war
nicht nur ein Aufbruch, sondern vielschichtig mit unterschiedlichsten Erwartungen, von den viele unerfüllt blieben oder gar enttäuscht wurden, zu Frustrationen führte. Es gibt einfach nicht „die
Westdeutschen“ und „die Ostdeutschen“, die man alle über einen Kamm scheren kann. Dies prägt auch das heutige Demokratieverständnis. Für Morina ist Demokratie kein fest fundamentiertes Gebäude,
sondern ein sich immer wieder fortwirkender Prozess – zumindest für die Bürger, wenn man sie nur eine aktivere Rolle spielen lassen würde. Das Nachdenken über das besondere deutsche Wesen der
Demokratie darf nicht aufhören, sondern muss immer wieder neu angestoßen werden.
Das vorliegende Buch ist eine deutsch-deutsche Demokratiehistografie aus der Froschperspektive der Bürger, die ihresgleichen sucht und die bisherigen Revolutionserzählungen um die Perspektive,
was eine Demokratie als Herrschafts- und Lebensform ausmacht, ergänzt. Die Erfahrungen und das Verständnis von Demokratie vor dem großen Aufbruch von 1989 sind wichtig für das unterschiedliche
Verständnis im wiedervereinigten Deutschland. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte ist noch lange nicht abgeschlossen und für die Autorin äußerst kritisch eingeordnet zu oft parteipolitisch
bestimmt und bei weitem nicht mit ihren ganzen Nachteilen aber auch Vorteilen in die Strukturen unseres heutigen Deutschlands integriert. Morina bricht die bisherigen Schemata über Ost und West
auf, in dem sie gerade die Ostperspektive als „Demokratie als Idee und Engagement mit offenem Ausgang“ bezeichnet. Nun gilt es für die demokratischen Parteien, dies aufzugreifen, in den
politischen Diskurs zu integrieren und dann die notwendigen Veränderungen unter Mitnahme und Beteiligung der Bürger vorzunehmen.
✔ Fazit: Authentisch und nachvollziehbar wird der Ausgangspunkt und die Veränderungen des Demokratieverständnisses sowie der Rolle der Bürger in Ost- und Westdeutschland vor und nach der Wiedervereinigung dargestellt.
Andreas Pickel
★★★★★
5 von 5
© 2024 Andreas Pickel, Harald Kloth, Cover: Copyright © Penguin Random House Verlagsgruppe
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Christian Morina: Tausend Brüche *Kindle bei amazon.de
*Hardcover bei amazon.de
John Walsh: Conan der Barbar
Die Entstehungsgeschichte des Kultfilms
Ludwigsburg ; Cross Cult ; 2023 ; 175 Seiten ; ISBN 978-3-98666-343-8

Nach Die Klapperschlange (2022) erschien 2023 mit Conan der Barbar ein weiteres Filmbilderbuch von John Walsh im Verlag Cross Cult.
Film- und Fantasyfans sollten sich dieses großformatige Werk nicht entgehen lassen. Auf 175 Seiten beschreibt Walsh die Entwicklung, Besetzung, Dreharbeiten und Postproduktion des Fantasystreifens aus dem Jahr 1982. Arnold Schwarzenegger hatte bis dahin nur in kleineren Rollen gespielt, sein großer Durchbruch als Filmschauspieler stand erst noch bevor.
Das reich bebilderte Filmbuch beginnt mit der Geschichte des Schöpfers von Conan, Robert E. Howard. Es zeigt die Entwicklung der Romanvorlage zur Comicfigur. Wunderschön anzuschauen sind die ganzseitigen Abbildungen von Fantasykünstler Frank Frazetta. Aber auch die teils seltenen Konzeptentwürfe und Produktionszeichnungen von Designer Ron Cobb lassen das Fanherz höher schlagen. Walsh beschreibt im Kapitel Entwicklung ausführlich das schwierige Zusammentreffen von Schwarzenegger mit Produzent Dino de Laurentiis. Dieses endete mit einem Rauswurf Schwarzeneggers. Später lenkte de Laurentiis aber ein. Schließlich wird auch Regisseur John Milius ausführlich beleuchtet. Dieser liebte kriegerische Figuren und übernahm den Regiestuhl von Oliver Stone. Auch die Nebenfiguren waren mit James Earl Jones (als Thulsa Doom), Sandahl Bergman (als Valeria) oder Mako (als Akiro, der Zauberer der Hügel) ausgezeichnet besetzt. Im Kapitel Postproduktion wird auch noch auf die Musik von Basil Poledouris und die Plakatkunst von Renato Casaro, Frank Frazetta, Seito und Ron Cobb eingegangen.
✔ Fazit: Beeindruckendes Filmbuch zu einem bedeutenden Fantasy-Klassiker der 1980er Jahre.
Harald Kloth
★★★★★
4/5 von 5
© 2025 Harald Kloth, Cover: Copyright © Cross Cult Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
John Walsh: Conan der Barbar *Hardcover bei amazon.de
Startseite → Sachbücher → Film
Lautlos im Weltraum
Original: Silent Running, 1972
Regie: Douglas Trumbull
In der Zukunft: Mit drei weiteren Astronauten ist Freeman (!) Lowell (Bruce Dern) seit Jahren auf dem Raumfrachter Valley Forge unterwegs. In riesigen Kuppeln transportieren diese Raumschiffe die letzten Wälder der Erde. Während Freeman sich liebevoll um Flora und Fauna kümmert, können seine Kollegen den Pflanzen und Tieren nur wenig abgewinnen. Lowell erntet selbst angebaute Lebensmittel, währen die anderen synthetische Nahrung bevorzugen und mit natürlicher Nahrung nichts anfangen können. Als die Valley Forge den Befehl erhält, aus Kostengründen die Biosphären zu sprengen und zur Erde zurückzukehren bricht für Lowell sein Lebenswerk zusammen. Widerwillig tötet er seine Kameraden und steuert das Raumschiff in Richtung Saturnringe, um die letzten Wälder zu retten ...
Die 1970er Jahre brachten hervorragende Science-Fiction-Filme hervor. Nach den gesellschaftlichen Umbrüchen in den 1960er Jahren befassten sich futuristische Filme nun auch verstärkt mit gesellschaftlich relevanten Themen und Bedrohungen. So z. B. »... Jahr 2022 ... die überleben wollen« (1973) und »Flucht ins 23. Jahrhundert« (1976) mit Überbevölkerung. »Der Omega-Mann« (1971) und »Andromeda - Tödlicher Staub aus dem All« (1971) mit bedrohlichen Viren und Bakterien. »Colossus« (1970) warnt vor Künstlicher Intelligenz und »THX 1138« (1971) vor Totalitarismus.
»Lautlos im Weltraum war für Douglas Trumbull (nach seiner Mitarbeit in Stanley Kubricks »2001: Odyssee im Weltraum«) seine erste Regiearbeit. Er war ein, für Universal Studios, günstig produzierter Independent-Film. In wenigen Szenen, z. B. als Lowell sich außerhalb des Schiffs begibt, sieht man ihm das auch deutlich an. Doch grundsätzlich ist Trumbull (der volle Kontrolle über den Schnitt hatte) mit seinem Streifen ein kleines Meisterwerk gelungen. Viele der Szenen wurden kostengünstig auf dem ausgemusterten Flugzeugträger USS Valley Forge (CV-45) gedreht. So konnte mittels Umbauten eine sehr glaubhafte Raumschiffatmosphäre erzeugt werden.
Später sind die einzigen Gesprächspartner des einsamen Astronauten drei Arbeitsdrohnen. Diese drei Roboter benennt er nach Comicfiguren (Huey, Dewey und Louie). Unter der Verkleidung steckten in Wirklichkeit körperbehinderte Menschen. Ein genialer Einfall, da dadurch eine ungeheure Emotionalität in Bezug auf die kleinen Maschinen erzeugt wurde. Die Schlusszene, in der Lowell einen Roboter verabschiedet, ist eine der anrührendsten Szenen in der Science-Fiction-Filmgeschichte.
Die Sängerin Joan Baez steuerte Songs zum Soundtrack bei. Der Titel »Rejoice in the Sun« passt einfach perfekt zu diesem ökologischen Science-Fiction-Film und auch perfekt in diese Zeit.
Was ich an »Silent Running« sehr schätze ist seine geradlinige, nicht unnötig komplizierte Handlung. Sondern eine klare (ökologische) Botschaft. Lowell begeht für seine Überzeugung ein schlimmes Verbrechen, doch man versteht wieso. So ist dann auch das Filmende nur konsequent.
Koch Media veröffentlichte 2014 »Lautlos im Weltraum« erstmals als Blu-ray mit interessanten Extras wie Interviews mit Douglas Trumbull und Bruce Dern. Vor allem ersteres enthält viele Infos zur Entstehungsgeschichte und den Dreharbeiten. Das limitierte Steelbook ist optisch ansprechend, aber ohne Innendruck.
Fazit: Science-Fiction trifft auf Ökologie. Ein Science-Fiction-Film-Klassiker mit viel Gefühl.
Harald Kloth

© 2025 Harald Kloth
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Lautlos im Weltraum *DVD bei amazon.de
*Blu-ray bei amazon.de
Blu-ray Steelbook *Blu-ray bei amazon.de
Colossus
The Forbin Project
1970
Regie: Joseph Sargent
Im Auftrag der US-Regierung hat der Wissenschaftler Dr. Charles Forbin (Eric Braeden) einen gigantischen Supercomputer entwickelt. Ziel ist es, die Verteidigung der Vereinigten Staaten, in die Hände eines Systems zu geben, das sich nicht mehr von menschlichen Emotionen leiten lässt, unbestechlich ist und keine Fehler macht. So soll Frieden und Sicherheit für die Menschheit gewährleistet werden.
In beeindruckenden Bildern am Filmanfang sieht der Zuschauer wie Forbin das riesige Elektronengehirn startet und es von der Außenwelt abschottet. Mit großer Medienshow informiert der US-Präsident (Gordeon Pinsent) dann die Weltöffentlichkeit über die Existenz und die Aufgaben von Colossus. Als die Maschine seinen Betrieb aufnimmt und seine weltweiten Kommunikationsverbindungen etabliert, kommt es zu einem Zwischenfalll. Die Maschine entdeckt in der Sowjetunion ein fast identisches System: Guardian. Die beiden Computer vernetzen sich und kommunizieren. Ihr Datenaustausch ist aber für Menschen bald nicht mehr nachzuvollziehen. Die Regierenden in Ost und West sind entsetzt, man fürchtet Geheimnisverrat. Forbin kappt auf Befehl des US-Präsidenten die internationalen Anbindungen. Daraufhin drohen Colossus und Guardian mit dem Abschuss von Atomraketen, sollten die Verbindungen nicht wiederhergestellt werden. Das Team um Dr. Forbin muss nun mit allen Mitteln versuchen, die Kontrolle wiederzuerlangen.
Zwei Jahre nach dem großen Science-Fiction-Klassiker »2001: Odyssee im Weltraum« wehrt sich erneut ein Computer gegen seine Abschaltung, wieder mit fatalen Folgen für die Menschen. Schon Ende der 1960er Jahre sorgte der Computer M5 in der gleichnamigen Folge der Serie »Raumschiff Enterprise« (S2/E24) für Tote. Auch »Colossus« kann als weiteres frühes Beispiel im Aufzeigen der Gefahren von Künstlicher Intelligenz dienen. Der Klassikerstatus von Stanley Kubrick´s Meisterwerk »2001« wurde nie erreicht. »Colossus« ist ein gut gealteter, spannender Sci-Fi-Thriller und wirft interessante Fragen auf. Der US-Präsident wirkt geradezu erleichtert, als er die Verantwortung über das Atomwaffenarsenal einer Maschine anvertrauen kann.
Die Filmadaption entstand nach einem Drehbuch von James Bridges (»Das China-Syndrom«, 1979) und basiert auf dem gleichnamigen Roman von D. F. Jones (Goldmann, 1968). Auch der zweite Roman der Colossus-Trilogie »Der Sturz von Colossus« erschien in deutsch (Goldmann, 1975). Der dritte Teil »Colossus and the Crab« (Berkley, 1977) ist nur im Original erschienen.
✔ Fazit: Kammerspielartiger Science-Fiction-Thriller, der die Themen Künstliche Intelligenz und menschliche Verantwortung früh stellte.
Harald Kloth
★★★★
4 von 5
© 2025 Harald Kloth
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Colossus - The Forbin Project *DVD bei amazon.de
*DVD bei amazon.de
*DVD bei amazon.de
*Blu-ray bei amazon.de
Laura Lichtblau: Sund
Roman
München ; C.H. Beck ; 2024 ; 130 Seiten ; ISBN 978-3-406-81377-1

In unzähligen Büchern zu Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes liegt der Schwerpunkt darauf, deren gesamte Grausamkeit in einer möglichst martialischen und schreckenerregenden Sprache
darzulegen. Meist geht es um die Erfahrung und den Umgang mit Gewalt in einem durch Kriegserfahrungen stimulierten Umfeld. Ja, Krieg ist grausam, das sieht man derzeit auch wieder an den Bildern
über das Leiden in der Ukraine oder im Nahen Osten. Aber Krieg und Völkermord kann auch Jahrzehnte danach in einer anderen entgegengesetzten Art und Weise gerade die Psyche belasten. Das ist
dann, wenn man gewohnt ist, Fakten, alles, was einen auch nur im Entferntesten betrifft zu kennen und somit auch keine Zeit damit verbringen muss, über irgendetwas nachzudenken, aber man dann
urplötzlich Ungereimtheiten und Lücken in den vermeintlichen Fakten erkennt, die man nicht erklären und auflösen kann. Dieses Gefühl vermittelt in eindringlicher Manier Laura Lichtblau in ihrem
sprachlich herausfordernd geschriebenen (Tage-)Buch: »Sund«.
Laura Lichtblau, knapp 40 Jahre, ist freie Autorin, Schriftstellerin und Übersetzerin. Neben »Sund« publizierte sie zwei Bücher, 2017 ein Kinderbuch und 2020 den Roman »Schwarzpulver«.
Die Autorin erzählt in der Ich-Form und befindet sich im Spätsommer auf Urlaub am „Sund“. Ein Sund ist in skandinavischen Ländern die Bezeichnung für eine Meerenge. In dem vorliegenden Roman, der
in einer Meerenge zwischen Schweden und Dänemark spielt, dürfte es sich somit um den „Öresund“ handeln.
Dabei erzählt sie ihrer namentlich und auch ansonsten nicht näher bekannten Geliebten, einem „Du“, ihre Eindrücke, Empfindungen, Erlebnisse von ihrem Urlaub auf einer Insel am Sund. Wer nun
glaubt, es handelt sich um eine entspannte, mit Meeresrauschen unterlegte Strandlektüre, liegt komplett falsch.
Der Grund, dort Urlaub zu machen sind Nachforschungen über den Urgroßvater der Erzählerin, erst später erfahren wir, er heißt Max Lange, der eigentlich als Orthopäde im Nationalsozialismus tätig
war. Auf ihrem Arbeitstisch im Zimmer der Unterkunft stapeln sich Aktenordner voll mit historischem Material, Briefe, Fragebögen und ein Buch ihres Großvaters. Nach und nach entwickelt die
Geschichte nun einen Sog auf den Leser, der einem das Buch nur mit kurzen Zwischenpausen lesen lässt.
Die (bi-sexuelle) Autorin wartet auf ihre Geliebte und als die nicht kommt begibt sie sich auf die zum Urlaubsort nahegelegenen Insel Lykke und lernt auf der Überfahrt die „Neue“ kennen. Dort in
Lykke finden beide Unterkunft im dortigen Ferienheim einer sektenähnlichen Esoterik-Gemeinschaft. Da beide Frauen als fremd auf der Insel gelten, ja sogar als Hexen bezeichnet werden, werden sie
zu einer Art Verbündete in der Fremde. Auf dieser Insel lag die berüchtigte, 1911 gegründete Moorske Anstalt, in der in den Augen der Gesellschaft als unproduktiv oder homosexuell gebrandmarkte
Menschen einkaserniert wurden. Die Inselbewohner schweigen heute noch darüber, versuchen zu vertuschen und beobachten mit Argwohn die Recherchen der Autorin.
Die Erzählerin verbindet nun mühsam, aber damit umso Schmerzhafter die Geschichte der Insel mit ihrer Familiengeschichte, spiegeln sich doch darin die Grausamkeiten der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wider. Die Autorin findet heraus, dass ihr Urgroßvater, eigentlich „nur“ Orthopäde“, dem Beirat von Karl Brandt angehörte, dem mächtigsten Mediziner in der NS-Diktatur und
Protagonist des Euthanasie-Programms, in Rahmen dessen zig-tausende Menschen ermordet wurden. Daneben war ihr Urgroßvater Mitglied der NSDAP und in vielen Verbänden, wie NS-Ärztebund oder auch
der „Deutschen Akademie zur wissenschaftlichen Pflege und Erforschung des Deutschtums“, die seine Haltung als strammen „Regime-Mediziner“ unterstreicht. Auf 30 Seiten taucht die Autorin nun immer
tiefer in die grausamen medizinischen Forschungsprogramme der Nazis hinein: „Karl Brandt war Leiter des Euthanasieprogramms. Mein Urgroßvater war Teil seines Beirats. Mehr weiß ich
nicht.“ So lautet jedenfalls ein Zwischenfazit, einen Beweis für oder gegen eine aktive Beteiligung ihres Urgroßvaters, nach dem Jahrzehnte nach dem Krieg ein Platz in Bad Tölz benannt
wurde, findet sie nicht. Ihre Absicht, mit den Recherchen auch die Geister, die sie bei diesem Thema umschweben zum Schweigen zu bringen, gelingt ihr also nicht vollumfänglich. Ein Buch, welches
ihr Urgroßvater geschrieben hatte als Grundlage nehmend, recherchiert sie akribisch alles Mögliche über die Beiratsmitglieder Brandts und deren Projekte mit Menschenversuchen. Konkrete
unmenschliche Aktivitäten, an denen ihr Urgroßvater beteiligt war, findet sie jedoch nicht. Sie umkreist so das Thema, schließt lediglich einige aber bei weitem nicht alle Lücken und schafft es
letztendlich so nicht, an den Kern der Wahrheit zu gelangen. Aufgrund vieler Unklarheiten letztendlich in all den historischen Dokumenten bleibt vieles nur eine Art vage Ahnung. Danach kehrt sie
an den Sund zurück, bis sie schließlich auch diese Insel wieder verlässt.
Lichtblau gelingt es exzellent, eines der düstersten Kapitel der eh schon dunklen Zeit des Nationalsozialismus mittels eines Romans über einen Inselaufenthalt zu rekonstruieren. Am Beispiel der Insel Lykke verbildlicht sie eine Insel als Obergriff von separiert sein vom Normalen, sinnbildlich für das Euthanasieprogramm, die schweigenden Inselbewohner stehen sinnbildlich für Millionen von Menschen, die im NS-Regime vom Judenmord nichts gesehen und gehört haben möchten, geschweige denn beteiligt gewesen sein sollen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte dann in vielen Familien, ja gesamtgesellschaftlich kollektiv das Vergessen ein. Für uns alle steht dieser Roman!
Die Morde des NS-Regimes waren nicht zu vertuschen, aber all die grausamen Details, die Täter, meist ganz normale Bürger wie du und ich, kamen erst durch akribische Recherchen einiger weniger Historiker aber auch Familienangehöriger von NS-Größen und ermordeten Juden ans Licht. Das Ganze verpackt Lichtblau lyrisch und poetisch, für manchen vielleicht in Teilen in zuviel Prosa, zu verspielt.
Lichtblaus Büchlein ist beeindruckend in seinen Natur- und Situationsbeschreibungen und in ihrer sehr bildhaften Charakterisierung der Menschen in ihrer Umgebung. Die Mischung aus Erzählung und Rechercheergebnissen, aus Beschreibungen der Umwelt sowie des Umfelds der Erzählerin und ihrem Innenleben, ist selten so interessant und fesselnd gelungen. Lichtblau gelingt es mit ihrem Buch auch damit beizutragen, dass eben nicht die Gespenster der dunklen Vergangenheit verschwinden, sondern real, greifbar bleiben.
Es ist schwer zu sagen, was genau der Roman ist – eine klassische Darstellung einer Familiengeschichte jedenfalls nicht. Was war, darf nie wieder sein, möchte man im Sinne Lichtblaus sagen. Lichtblau will sie diejenigen hervorheben, die für millionenfaches Leiden gesorgt haben. Nicht aus Ehrerbietung natürlich, sondern, um sicherzugehen, dass die Leidbringer dieser Welt sich nie wieder erheben.
✔ Fazit: Ein nicht immer einfaches, doch wunderbar zu lesendes Büchlein über Vergangenheitsbewältigung, Vergessen und auch Vertuschen von Verstrickungen von Verwandten und Bekannten des Ansehens Willens. Aufmerksam beobachten und das Aufgefasste unaufgeregt, aber doch lesenswert zu Papier zu bringen, können nur wenige. Lichtblau kann es!
Andreas Pickel
★★★★
4 von 5
© 2024 Andreas Pickel, Harald Kloth, Cover: Copyright © Verlag C.H. Beck
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Laura Lichtblau: Sund *Kindle bei amazon.de
*Hardcover bei amazon.de
Bloody Marie
Eine Frau mit Biss
Original: Innocent Blood, 1992
Regie: John Landis
Regisseur John Landis konnte mit Filmen wie »Ich glaub`, mich tritt ein Pferd« (»National Lampoon´s Animal House«, 1978), »Blues Brothers« (1980), »American Werewolf« (1981) oder »Die Glücksritter« (»Trading Places«, 1983) große Publikumserfolge feiern.
Mit »Bloody Marie - Eine Frau mit Biss« widmete er sich nach seinen bahnbrechenden Genrefilmen zu Werwölfen (»American Werewolf«) und Zombies (Michael Jackson´s Musikvideo »Thriller«) erneut einem Horrorthema, dem Vampirfilm. Die Vampirin Marie (sexy dargestellt von Anne Parillaud) wählt in Pittsburgh Mafiamitglieder als perfekte Opfer im Großstadtschungel aus. Doch beim Gangsterboß Macelli (Robert Loggia) versagt sie. Der brutale Mafiosi baut sich eine Gangstergruppe aus Vampiren auf. Gemeinsam mit Cop Joe Gennaro (Anthony LaPaglia) versucht sie dies zu verhindern.
Leider wirkt diese Vampirkomödie im Gegensatz zu Landi´s früheren Klassikern eher schlecht gealtert. Die Balance zwischen Action-, Horror- und Komödienelementen stimmt oft nicht. Auch die Liebesbeziehung zwischen Marie und Joe funktioniert nicht wirklich gut. LaPaglia bleibt in seiner Darstellung leider recht farblos.
Auf der Habenseite finden sich aber zahlreiche (Gast)auftritte bekannter Schauspieler und Filmlegenden: Dario Argento, Angela Bassett, Kim Coates, Luis Guzmán, Franz Oz, Sam Raimi, Tom Savini oder Tony Sirico.
Die bisherige DVD aus dem Jahr 2006 war noch mit FSK 18 freigegeben. Plaion Pictures veröffentlichte 2024 »Bloody Marie - Eine Frau mit Biss« erstmals ungekürzt auf Blu-ray mit FSK 16. Das Mediabook enthält auch die DVD und hat auf der Vorder- und Rückseite ein schönes Artwork in edler Optik. Ein 20seitiges Booklet von Nicolai Bühnemann beschäftigt sich ausführlich mit dem Filmschaffen von Regisseur John Landis. Ein Highlight dieser Edition ist aber auf der Blu-ray zu finden: John Landis wurde auf dem 74. Locarno Film Festival der Ehrenpreis verliehen. In einem Podiumsgespräch (78 MInuten lang und deutsch untertitelt) gibt er viele Geschichten aus seinem jahrzehntelangen Filmschaffen zum Besten. Wie er ursympathisch und mit großer Bühnenpräsenz aus seinem bewegten Filmleben erzählt, ist herrlich anzuhören.
Fazit: Leider nur durchschnittliche Vampirkomödie des großartigen Genrespezialisten John Landis.
Harald Kloth

© 2024 Harald Kloth
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Bloody Marie *Mediabook bei amazon.de
Ramar: Digger
Leipzig ; Kult Comics ; 192 Seiten ; Hardcover ; ISBN 978-3-96430-320-2

Ein düsteres Gefängnis. Es thront auf einem Felsen im Nirgendwo, neben dem Meer. Weder Ort noch Zeit werden genau bestimmt. Der Neue wird in die Anstalt eingeliefert. Er ist riesig und braucht
den Platz von fünf Gefangenen. Schnell erhält er den Spitznamen Digger. Digger hat ein Geheimnis. Dieses Geheimnis soll ihn aus dem Gefängnis bringen. Dafür versucht ihn bald ein Mithäftling
abzustechen. Die Tat misslingt und Digger kommt in Einzelhaft. Er will einfach nur noch in Ruhe gelassen werden. Neben einer Möwe wird der Mithäftling Manalas, der einzige Freund von Digger. Er
bringt den Bücherwagen zu den Zellen und auch andere Sachen. Und bald stößt auch Manalas auf Diggers Geheimnis ...
Ganze 70 Seiten bleiben die Panels in Digger schwarz-weiß. Erst spät schleicht sich ein leichter blauer Farbton der Freiheit ein. Eine Möwe am Himmel, gespiegelt in Diggers Brille. Dann folgt
eine einzelne gelbe Blume (Seite 106) und die wichtige blaue Strickmütze (ab Seite 115). Diese Farben wirken in den tristen Grauschattierungen wie Leuchtfeuer der Hoffnung. Erst die letzten zehn
Seiten sind dann komplett farbig.
Ralf Marczinczik (Ramar) hat für mich mit Digger den Comic des Jahres geschaffen. Er ist witzig, traurig, melancholisch und vor allem hoffnungsvoll. Die Figuren im Funny-Stil, in Verbindung mit
den harten, realistischen Gefängnisbildern wirken so, als ob Mordillo auf Flucht von Alcatraz getroffen wäre. Und obwohl gar nicht mal so viel Handlung passiert, saugt die Geschichte den Lesenden
immer tiefer ein. Einziges Manko: Ein größeres Format wäre für den Hardcoverband im Kleinformat toll gewesen.
✔ Fazit: Wenn Sie sich 2024 nur einen Comic kaufen, dann sollte es dieser sein!
Harald Kloth
★★★★★
5 von 5
© 2024 Harald Kloth, Cover: Copyright © Kult Comics
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Ramar: Digger *Hardcover bei amazon.de
Simon Shuster: Vor den Augen der Welt
Wolodymyr Selenskyj und der Krieg in der Ukraine
München ; Goldmann ; 2024 ; 528 Seiten ; ISBN 978-3-442-31724-0

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022, ist dieser Krieg auch medial nachhaltig beeinflusst durch seine beiden Protagonisten, den beiden Präsidenten Selenskyj und Putin.
Während sich bei Putin die Literatur und westliche Medien (bewusst) bedeckt halten, um seine diktatorische Machtausübung sowie sein Expansions- und Großmachtstreben nicht weiter zu verherrlichen,
ist der ukrainische Präsident in seinem ständigen Bemühen um finanzielle Mittel und vor allem westliche Waffenlieferungen omnipräsent. Man könnte annehmen, er hätte sein ganzes Leben nichts
anderes getan, als den „toughen“, in seinem stetigen Verlangen renitenten Staatsmann aber vor allem Feldherrn zu spielen. Dabei war er zu Beginn seiner beruflichen Karriere wirklich ein
„Spieler“, genauer Schauspieler und Komödiant. Diesen Werdegang vom früher russlandaffinen Bühnenakteur auf die weltpolitische Bühne eines nun gegen Russland als Kriegsherrn agierend müssenden
Staatspräsidenten zeichnet Simon Shuster nach.
Der im letzten Jahr 50 gewordene Autor Simon Shuster ist Korrespondent für das amerikanische Nachrichtenmagazin TIME und lernte Selenskyj Anfang 2019 bei einer Show kennen, also in einer Zeit als
dieser noch eher ein Komödiant mit politischen Ambitionen war. Shuster wurde in Moskau geboren und emigrierte als Kind zwei Jahre vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion in die Vereinigten Staaten.
Shuster gilt als exzellenter Kenner des russisch-ukrainischen Konflikts, seit der russischen Annexion der Krim im Jahr 2014 berichtet er ausführlich über den Krieg in der Ukraine. Er lebt in New
York verbringt aber derzeit einen Großteil seiner Zeit in Kiew.
Selenskyj, erst 46 Jahre alt, kam am 20. Mai 2019 nach einem erdrutschartigen Sieg seiner Partei „Diener des Volkes“ an die Macht und war zunächst gezwungen, den Wechsel von der fiktiven Welt
eines sehr erfolgreichen Comedians hin zu einem starken Präsidenten eines Landes voller Korruption und einflussreichen Oligarchen zu vollziehen. Gleich nach Amtsantritt spürte er was es heißt im
absoluten Rampenlicht zu stehen, als er seine Vermögensverhältnisse offenlegen musste und dies die Medien in allen Details ausbreiteten, dass er nicht nur vermögend war, was vielen ja bekannt
war, sondern wie reich er war. Zu einer Art Chamäleon wurde er jedoch dann nach dem russischen Einmarsch in die von ihm geführte Ukraine, in dem er sich zum selbstbewussten Kriegsherrn mit einer
beeindruckenden Hartnäckigkeit und Widerstandskraft entwickelte. Shuster charakterisiert ihn hier treffend als „… hartnäckig, selbstbewusst, rachsüchtig, unpolitisch, mutig…, resistent gegen
Druck und schonungslos gegenüber allen, die sich ihm in den Weg stellten…“ Mitarbeiter bezeichneten ihn sogar als „Entscheidungsgenerator“. Dieses Verhalten und seine Charaktereigenschaften,
und das vorab auch als zusammenfassende Kernaussage des Buches, übertrugen sich ebenso auf sein an allen Fronten kämpfendes und Entbehrungen hinnehmendes Volk, das auch jetzt noch mit einer nie
geglaubten Resistenz dem an Ressourcen weit überlegenen Aggressor begegnet und wiedersteht.
Unmittelbar nach dem Beginn der Invasion glaubte jeder im Westen an einen schnellen Fall Kiews. In der Konsequenz wurde anstelle von passiver Unterstützung der Verteidigungsanstrengungen, z.B.
mittels militärischer Beratung und vor allem Waffen, zu Beginn lediglich politisches Asyl und Hilfe bei der Einsetzung einer Exilregierung angeboten. Doch vom ersten Tag an zeigte Selenskyj, dass
er nicht gewillt war, sich dem Druck zu beugen. Von einem Bunker aus führte er die Regierungsgeschäfte, warb um Unterstützung, besuchte die Front und Shuster war meist mit dabei. Im Bunker hatte
Selenskyj eine Art eigene Suite, mit Küchenzeile, Essbereich, eigenem Bad, aber den Umständen geschuldet doch relativ spartanisch. Der Originaltitel des Buches lautet im Gegensatz zum eher
pompösen deutschen Titel nüchtern „The Showman“ und das spiegelt eigentlich den ganzen Charakter Selenskyjs gut wieder: egal wie schwierig die Situation auch ist, eine sehr kommunikative und vor
allem überzeugende Art, diese zu vermitteln. Zu vermitteln nicht nur, was jeder in den heutigen „Echtzeitmedien“ selbst sehen kann, sondern dies verbunden mit wahrhaftigen Emotionen und
Situationsbeschreibungen.
Neben dieser Widerstandskraft spielten Selenskyj natürlich auch die anfangs teils dilettantischen Fehler der russischen Armee auf allen Ebenen, taktisch, operativ, strategisch, in die Karten. Die
russischen Streitkräfte gingen nach Schema-F vor, Initiative, Kühnheit, Überraschungsmomente gab es nicht bzw. waren oftmals auch politisch nicht gewollt. Alleine im ersten Kriegsmonat verlor
Russland mehr Soldaten als in 10 Jahren Afghanistankrieg, in den zwei Wochen in der Schlacht um Donbass mehr Soldaten als die USA in 20 Jahren im selben Land, wie Shuster richtig schreibt, Dabei
war der Blutzoll nicht nur gegen die reguläre ukrainische Armee hoch, sondern Polizisten, Jugendliche mit Drohnen und selbst alte Menschen mit privaten Waffen wie Jagdgewehren stellten sich der
roten Armee in den Weg. Anstelle eines eigentlich erwarteten riesigen Flüchtlingstrecks in Richtung Westen, kehrten alle nach Kiew zurück und wollten Teil dieses Triumphes sein. Für Shuster war
die Verteidigung Kiews DAS entscheidende Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg, da die Ukraine als Land erhalten blieb und Putin verwehrt wurde, plötzlich an der polnischen Ostgrenze zu stehen, das
Großmachtstreben Russland einen immensen Schaden erlitt sowie andererseits auf ukrainischer Seite ein enormes Selbstbewusstsein zum Tragen kam. Dies hat sich aber nach einigen Personalwechseln
sowie einem verstärkten Bombardement aus der Luft und mit Fernraketen („Shock and Awe“ - Schrecken und Furcht) in den letzten Monaten schlagartig geändert, was dazu führte, dass die russische
Armee derzeit die Oberhand an fast allen Fronten hat. Ein Wende wieder zugunsten der Ukraine ist derzeit nur mit kontinuierlichen Waffenlieferungen aus dem Westen
vorstellbar.
Shuster beschreibt zu Beginn auch den wesentlichen Grund für den Angriff Putins: die Orange Revolution, die Ende 2004 ihren Anfang hatte und an deren Ende die Abneigung gegen jeglichen weiteren
russischen Einfluss in der Ukraine Vorrang hatte und stattdessen dem Lied der Pet Shop Boys „Go West“ folgend, die Annäherung an den Westen stand. Selenskyj, zu jener Zeit auf dem Weg zu einem
berühmten Comedian, machte damals mit seiner Truppe Witze, die selbst seine Mutter als beängstigend betrachtete, über die Revolution und verfolgte umfangreiche geschäftliche Beziehungen mit
Russland.
Putin stattdessen tat schon früh kund, dass er sich mit den Ergebnissen der Revolution nicht abfinden werde. Der Einmarsch in die Krim folgte seinen Worten. Dieses Ereignis war auch für Selenskyj
der Anlass, das erste Mal so richtig politisch in Erscheinung zu treten, kritisch gegenüber der eigenen Regierung aber auch mit klaren Worten an Putin gerichtet. Ende 2014 stellte er unter
Hinnahme eklatanter finanzieller Konsequenzen die Bühnenarbeit in Russland ganz ein. Während er seinem Manager Tyra bereits im April 2018 bei einer Autofahrt im Rahmen seiner Deutschlandtournee
preisgab, als Präsident zu kandidieren, weihte er seine Frau und Freunde erst im folgenden Herbst in seine Pläne ein. Nachdem viele Ukrainer den Amtsinhaber Poroschenko für einen gescheiterten
Frieden verantwortlich machten, war Selenskyj kurze Zeit später, also zu Begin 2019, bereits Favorit auf das Amt und wurde schließlich auch
gewählt.
In der Frühphase des Krieges ließ der ukrainische Präsident den militärischen Part des Krieges durch die Experten und Militärs führen, insbesondere durch Saluschnyi, den militärischen
Oberbefehlshaber, den Selenskyj im Frühjahr 2021 persönlich an allen Hierarchien vorbei an die Spitze der ukrainischen Armee hievte. Dies auch mangels eigener militärischer Erfahrungen und damit
bedingt Selbstvertrauen, die Operationsführung seiner Militärs zu hinterfragen. Er dagegen konzentrierte sich auf das Wahrnehmen, was an der Front passierte, und adressierte diese Wahrnehmungen
in Videobotschaften. Interviews und Pressekonferenzen nahe der Front selbst unter Gefahr einem Bombenangriff zum Opfer zu fallen, schreckten Selenskyj nicht ab, Zuversicht zu verbreiten. Später
dann übertrug oder besser impfte er in unzähligen Inlands- und Auslandsreisen seinem Volk seine Widerstandskraft sowie Optimismus ein und bat die westlichen Länder und Institutionen, wie z.B. die
EU, permanent, ja fast schon penetrant um Unterstützung. Die westliche Welt sollte jederzeit das Leid des ukrainischen Volkes vor Augen geführt werden, um zu helfen und diese Hilfe darf auch
nicht nachlassen. Dies unermüdlich bis zur totalen Erschöpfung, auch und gerade jetzt, als der Nahe Osten und die Unterstützung von Israel mehr in den Fokus der westlichen Staaten rückte.
Dem ist, wenn man dann die Phase nach dem Erscheinen des Buches nimmt, nicht mehr so. Nach und nach bringt sich Selenskyj auch in die militärischen Strategie- und Gefechtsplanung mit ein. Nicht
zuletzt tauschte er auch Anfang Februar 2024 neben dem Generalstabschef auch manch anderen General in leitender Position aus. Diese „Einmischung“ deutet Shuster auch am Ende des Buches in einer
Art Ausblick an, auch in einem Ausblick auf eine „Post-War-Szenario“, in dem er sohr wohl die Möglichkeit sieht, dass Selenskyj die ihm nun per Kriegsrecht auferlegten zusätzlichen
Zuständigkeiten dann auch behalten und eben nicht zur vollen Rechtstaatlichkeit zurückkehren möchte. Selenskyj versucht sicherlich weiterhin, um sich herum einen elitären Kreis an dynamischen,
handlungswilligen und -fähigen Männern und Frauen aufzubauen, die er aber jederzeit von sich abhängig und damit kontrollierbar macht. Ähnlich wie in Russland sind alle personellen und materiellen
Ressourcen zentral zu mobilisieren und einzusetzen. Ob das System sich so in Richtung einer einzelnen Person an den Machthebeln verselbständigt, wird man sehen. Das heißt plakativ ausgedrückt,
Selenskyj muss sich dann entscheiden, ein Staatspräsident im Nadelstreifenanzug und mit weißem Hemd zu sein oder wie jetzt in militärischer Uniform.
Ein Teil des Buches behandelt auch das Ringen Selenskyjs um eine diplomatische Einigung mit Russland. Lange Zeit setzte er auf diese Karte, hoffte, Putin doch irgendwie zu einem Kompromiss
bringen zu können. Selbst nach den entdeckten Gräueltaten russischer Soldaten in Butscha gab er sich weiterhin der Illusion hin, mit Putin verhandeln zu können. Doch weit gefehlt: Putin zeigte
alsbald noch „spitzere Zähne“ und sein wahres Gesicht. Nach und nach erst sah Selenskyj die Sinnlosigkeit dieses Vorhabens.
Selenskyj selbst hielt die Biografie über sich für einen 46-Jährigen eigentlich als zu früh. Aber ich denke, er hat sie letztendlich selbst gutgeheißen, weil sie seinen bisherigen Weg exzellent
nachzeichnet. Dabei wechselt der Autor in seinen Erzählungen gekonnt zwischen Dialogen, Ereignisbeschreibungen, Meinungen sowie Gedanken. Das alles mal humorvoll mal ironisch, aber stets
erschreckend real. Shuster erläutert auf zwei Erzählebenen, einerseits aus der des Beobachters und „Wahrnehmers“, andererseits als unmittelbar Betroffener, nachhaltig einem breiteren Publikum das
Mysterium Selenskyj, seinen Aufstieg aus dem politischen Nichts und vor allem seine Überzeugungskraft. Dies einerseits nach innen zur Stärkung der Widerstandskraft und -willen seiner Bevölkerung
aber auch nach außen im permanenten Ringen um finanzielle und materielle Ressourcen. Shuster bildet durch eine Art „Schlüssellochblick“ einen teils neuen Blick auf die unmittelbare Umgebung von
Selenskyj, seiner Familie und entmythologisiert das lange vorherrschende Bild eines planlos agierenden ehemaligen Komödianten, unfähig ein Volk durch diese harten Zeiten zu führen.
Gerade auf Reisen bildete sich Selenskyj mit historischen Büchern auch zu den größten Feinden der Ukraine, Hitler und Stalin, weiter. Vergleiche mit Churchill konnte er nichts abgewinnen, im
Gegensatz zu Vergleichen mit Charlie Chaplin. Nur 170cm groß und selbst nie in der Armee gedient, zeigt Selenskyj seit Beginn der Invasion eine nie erwartete Größe und Kriegstüchtigkeit.
Shuster’s Buch klingt nicht wie eine Eloge auf einem Menschen, sondern spart auch nicht mit Kritik, wo angebracht, und ordnet die eine oder andere Situationsbeschreibung auch entsprechend ein. So
zum Beispiel das Versagen Selnskyjs, die Invasion nicht vorhergesehen zu haben bzw. alle Hinweise darauf weggewischt zu haben, selbst als das Land auch von Belarus aus von drei Seiten umzingelt
war. Sogar noch am Abend davor glaubte er nicht an einen Angriff, genauso wie auch deutliche Anzeichen, dass Auftragskiller auf ihn angesetzt waren. Die Hauptkritik an Selenskyj ist jedoch, dass
er Kritik an seiner Person nicht hören möchte, was er falsch entschieden und anders angeordnet hat. Dies ist so Shuster beängstigend, denn man braucht im engsten Zirkel auch Menschen, auf die man
hört, die einem nicht nur Halt geben, sondern auch einem den Spiegel vor die Nase halten, wenn man sich irgendwo verrannt hat. Hierin liegt die wesentliche Leistung des Buches. Quasi nebenbei
gibt er einen interessanten Einblick in die verborgene Privatsphäre der Entourage des ukrainischen Präsidenten und lieferte eine Beschreibung des ukrainischen Systems aus Macht und Politik gleich
mit.
✔ Fazit: Brilliante Biografie, die ein erschreckend realistisches Bild über die derzeitige Situation in der Ukraine zwei Jahre nach Kriegsbeginn zeichnet.
Andreas Pickel
★★★★★
4/5 von 5
© 2024 Andreas Pickel, Harald Kloth, Cover: Copyright © Penguin Random House Verlagsgruppe
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Simon Shuster: Vor den Augen der Welt *Kindle bei amazon.de
*Hardcover bei amazon.de
Patrick Oberholzer: Games
Auf den Spuren der Flüchtenden aus Afghanistan
Bielefeld ; Splitter ; 2023 ; 96 Seiten ; Hardcover ; ISBN 978-3-98721-253-6

Games, so nennt man die Versuche, über eine Grenze zu kommen.
Ziya
Die Themen Flucht und Migration bewegen seit vielen Jahren die westlichen Gesellschaften. Selbst reiche Volkswirtschaften wie Deutschland kommen an ihre Belastungsgrenzen. Politisch Radikale nutzen diese Überforderung und Ängste in der Bevölkerung für ihre eigenen Ziele.
Doch warum flüchten Menschen überhaupt? Wie flüchten diese Vertriebenen aus ihren Heimatländern? Welche Rolle spielen professionelle Schlepper in diesem System? Welche Fluchtrouten werden benutzt? Und was passiert mit den Flüchtlingen in Europa?
Der schweizer Illustrator Patrick Oberholzer versucht Antworten auf diese Fragen zu finden. Dazu erzählt er exemplarisch anhand von fünf Einzelschicksalen die Geschichten dieser Menschen.
Er beschreibt die Flucht von Hamid, der von den Taliban entführt wurde. Er erzählt von Muhammed, dessen Onkel bei einem Bombenanschlag beide Beine verlor. Wir erfahren von Ziya, der als Elektriker auf einer Militärbasis gearbeitet hat. Von Afsaneh, die mit 14 zwangsverheiratet wurde. Und von Nima, der in einer Schlepper-Familie aufgewachsen ist.
Patrick Oberholzer teilt die Graphic Novel in diverse Kapitel auf:
- Die Geschichte des Afghanistan-Konflikts
- Hintergründe
- Wie organisiert man seine Flucht?
- Iran
- Über die Berge/Türkei
- Wie viel kostet eine Flucht?
- Über das Meer/Griechenland
- Balkan
- Ankommen
- Ein Blick zurück
- Asyl in Europa
- Ablauf eines Asylverfahrens
Für dieses Comicwerk führte Oberholzer viele Interviews und Gespräche mit den Betroffenen. Seine ausgezeichnete Recherche macht sich in vielen detailreichen Hintergrundinfos bemerkbar.
Die Aufteilung der Panels folgt keinem festen Raster. So entstehen teils episch anmutende Seiten (beispielswese bei der Flucht über das Meer). Virtuos geht der Schweizer mit Farben um. Er versteht es meisterlich Farben als Stilmittel für Stimmungen einzusetzen. So wird man von einer beschaulichen Dorfidylle und Fischfang eine Seite weiter in ein Action-Panel mit heranrasenden Taliban katapultiert. Grafisch äußerst gelungen sind auch die Spiegelungen in Licht und Wasser. Die vielen Hintergrundinfos packt er in leicht verständliche Diagramme und Icons.
Der Comic »Games« von Patrick Oberholzer eignet sich auch hervorragend als Schullektüre. Auf seiner Website bietet der Autor dazu Informationen zum Download an.
✔ Fazit: Man kann eine Game gewinnen, aber auch verlieren. Aufgrund seiner Detailtreue ist diese dokumentarische Graphic Novel ein Genuß und ein Gewinn für alle, die mehr über dieses wichtige Thema wissen möchten.
Harald Kloth
★★★★★
5 von 5
© 2024 Harald Kloth, Cover: Copyright © Splitter Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Patrick Oberholzer: Games - Auf den Spuren der Flüchtenden aus Afghanistan *Hardcover bei amazon.de
Giuliano da Empoli: Der Magier im Kreml
Roman
München ; C.H. Beck ; 2023 ; 265 Seiten ; ISBN 978-3-406-79993-8

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022, ist dieser Krieg auch medial nachhaltig beeinflusst durch seine beiden Protagonisten, den beiden Präsidenten Selenskyj und Putin. Während über den ukrainischen Präsidenten mittlerweile einige bemerkenswerte Biografien erschienen sind, hält sich die Literatur bei Putin (bewusst) bedeckt, um seine diktatorische Machtausübung nicht weiter zu verherrlichen.
„Russland wurde noch nie von Händlern regiert. Und weißt du warum? Weil sie nicht in der Lage sind, die beiden Dinge zu gewährleisten, die die Russen vom Staat fordern: Ordnung im Inneren
und Macht nach außen“. Diese Sätze Putins aus dem Mittelteil (Seite 149) des bereits 2023 erschienenen Buches von Guiliano da Empoli fassen exzellent zusammen, warum Putin der
unumstrittene Herrscher Russlands ist. Da Empoli zeichnet in dem eigentlich fiktiven Roman die „Machtergreifung“ Putins nach und beschreibt gleichzeitig ein erschreckend realistisches Bild über
die Kräfteverhältnisse im Kreml und damit in Russland insgesamt.
Der Autor Guiliano da Empoli ist Professor für Vergleichende Wissenschaften an der Hochschule „Sciences Po“ in Paris und hat bereits mehrere Bücher zu politischen Themen verfasst. Ebenso ist er
Gründer von „Volta“ einem Think Tank mit Sitz in Mailand und war unter anderem Berater des italienischen Ministerpräsidenten Renzi. Er weiß also aus nächster Nähe, was Regieren und politische
Machtintrigen bedeuten.
Der Hauptdarsteller in dem Buch ist ein gewisser Wadim Baranow, in Realita soll es sich um den Regierungsberater und „Kreml-Chefideologen“ Wladislaw Surkow handeln, den die Neue Zürcher Zeitung
im Juni letzten Jahres als Putins grauen Kardinal bezeichnete. Der Rahmen des Romans ist einfach: ein Literaturwissenschaftler kommt nach Moskau, um über den russischen Schriftsteller Jewgeni
Samjatin zu recherchieren. Dabei wird er eben von diesem Baranow, der sich auf einem luxuriösen Landsitz lebend aus der aktiven Politik zurückgezogen hatte, zu einem Gespräch geladen und wir
werden Teil einer atemberaubenden Geschichte. Der Roman handelt im Folgenden von den Erzählungen Baranows über seine 15 Jahre als Berater Putins, eingerahmt von realen historischen Ereignissen
wie dem Fall der Berliner Mauer.
In dem Gespräch, was mehr einem Monolog ähnelt, öffnet Baranow dem Historiker wie in einer Art letzten Beichte sein Leben und man nähert sich nach und nach dem Aufstieg und Machtstreben des
eigentlich grauen und wenig charismatisch wirkenden Putin (Baranow beschreibt ihn als blass, blond, farblos mit Angestelltenmiene). Alle unterschätzten den ursprünglich so unscheinbar und
manipulierbar wirkenden Putin. Dies selbst die Oligarchen im engsten Machtzirkel, die ihn eigentlich als ihre eigene Marionette installieren wollten, um so die Politik zu ihren Gunsten zu
beeinflussen, um selbst noch reicher und mächtiger zu werden. Doch weit gefehlt: Putin zeigte alsbald „spitze Zähne“ und sein wahres Gesicht. Die Unterhaltung geht fast die ganze Nacht in der
Baranow das Wesen und den Charakter Putins eineindeutig offengelegt. Für Putin gibt es nur ein Mittel für seinen eigenen Machterhalt und die Rückkehr zum ehemaligen russischen Imperium: die
Gewalt!
Die Abschirmung der westlichen Welt von den wahren Zuständen im Machtzirkel Putins und die damit einhergehenden Unsicherheiten, da hilft nur noch der „reale Roman“ so könnte man meinen. Die
Erzählungen Baranows füllen fast den kompletten Roman, aber die Monologe sind alles andere als langweilig. Im Gegenteil, Baranow, übrigens die einzige fiktive Gestalt in dem Roman, kennt alle
Intrigen, Machtgeplänkel, Gesten und Mimik aus nächster Nähe und eigener Erfahrung. Schlüsselerlebnis für Putin war, als 1995 der damalige Präsident Jelzin sichtlich angetrunken zusammen mit dem
amerikanischen Präsidenten eine Pressekonferenz in Washington gab und Bill Clinton nur über ihn lachen konnte - es war symbolisch ein Auslachen des dahinsiechenden Russlands. Die ehemalige
Weltmacht Russland schien nur noch ein Spielball des westlichen Kapitalismus zu sein. Putin reaktiviert nun alle Sehnsüchte sowie Gelüste nach alter Stärke und etabliert sich quasi als
Heilsbringer des so gebeutelten Volkes, mit Baranow als seinen Berater.
Da Empolis Roman mag zwar fiktiv sein, aber niemand würde in Kenntnis der heutigen Situation bezweifeln, dass es sich genauso abgespielt hat, als Putin sich an die Macht im Kreml hievte. Der
Aufstieg Putins aus einem scheinbar unwichtigen Büro des KGB, des russischen Geheimdienstes, in den Kreml als die Macht- und Schaltzentrale, um nach „Glasnost und Perestroika“ die
Mächteverhältnisse des Kalten Krieges wiederherzustellen, werden nachvollziehbar wiedergeben. Den Menschen in einem Gefühl von Angst und Verunsicherung neues (zaristisches) Selbstbewusstsein
zurückzugeben, erhöhte umgehend die Popularität Putins und stärkte früh seine auch heute noch unverrückbare Position. Wer annahm, mit Putin eine Marionette der Oligarchen an die Macht gebracht zu
haben, wurde schnell selbst eine Marionette des Despoten. Putin scharte gerade in der Anfangsphase gezielt Personen um sich, die ihm nutzen konnten, als auch umgekehrt, von ihm später zu
profitieren – aber zu welchem Zeitpunkt auch immer, uneingeschränkte Loyalität war die Grundvorrausetzung. Putin entwickelte ein System, dass unterhalb von ihm von mehreren Machtsäulen getragen
wird, die miteinander verzahnt sind, aber sich auch nicht selten bekämpfen. So manches Unrechtbewusstsein wird so verschluckt, denn die Gesellschaft unmittelbar um Putin partizipiert
offensichtlich so ohne weiter darüber nachzudenken an der Ausgrenzung, Gefangennahme oder gar Tötung von Staatsfeinden, ohne nach eigenem Empfinden etwas moralisch Verwerfliches zu tun.
Der Roman ist gespickt von sehr interessanten Retrospektiven auf die neuere Geschichte. So zum Beispiel, als Baranow die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts als einen Wettstreit zwischen den
„Künstlern“ Hitler, Stalin und Churchill sah, danach folgten die Bürokraten, um in einer Phase von Frieden Wiederaufbau und Konsolidierung sicherzustellen. Doch nun sind es wieder die Künstler
welche die Fäden ziehen. Am Rande sei erwähnt, auch der jetzige ukrainische Präsident Selenskyj war ja Komiker sowie Schauspieler und damit Künstler, bevor er sich um das Präsidentenamt bewarb,
und eine Anspielung auch auf Trump liegt nahe. An einer Stelle des Buches wird das auf Putin bezogen sehr treffend beschrieben: ein Typus Schauspieler, der sich selbst inszeniert, der gar nicht
zu spielen braucht, weil er von seiner Rolle durchdrungen ist, dass die Handlung des Stücks zur eigenen Geschichte geworden ist, ihm durch die Adern fließt.
Putin baute um sich herum einen elitären Kreis an machthungrigen, dynamischen, handlungswilligen und -fähigen Männern auf, den Adel des Imperiums, die er aber jederzeit von sich abhängig und
damit kontrollierbar machte. Die patriotische Elite tut alles dafür, Russlands Unabhängigkeit gemäß den Befehlen Putins zu verteidigen. Alle personellen und materiellen Ressourcen sind zentral zu
mobilisieren und einzusetzen. Das System verselbständigte sich so in Richtung einer einzelnen Person an den Machthebeln. Bevor Russland immer periodisch jeweils auf ein neues Machtzentrum
zusteuert, kann man die Komposition des „Zentrums“ noch beeinflussen. Danach aber greift ein Rädchen in das andere, der Zarenhof ganz alleine bestimmt das Schicksal des Staates, jegliche
Einflussnahme oder gar Widerspruch, Auflehnung ist zwecklos. Ab da wird alles und jeder akribisch kontrolliert, Macht, Machtausübung und -erhalt sind bis ins kleinste Detail ausgeplant und
organisiert.
Dabei wechselt der Autor in den Erzählungen Baranows gekonnt zwischen Dialogen, Ereignisbeschreibungen, Meinungen sowie Gedanken. Das alles mal humorvoll mal ironisch, aber stets erschreckend
real. Macht in Russland bedeutet auch vage, unbestimmt, unklar zu bleiben. Freunde und Sympathisanten von heute können schnell als die zukünftigen Feinde des Regimes gelten und abserviert werden.
Diese Unsicherheit stärkt wiederum Loyalität und Stärkung der Macht der Zentrale. Das russische Volk kann mit Diversität nichts anfangen, es hat eine ganzheitliche Auffassung von Macht. Putin hat
die einzigartige Gabe, wie eigentlich nur Zaren, nicht nur vorzugeben, die Geschicke des Staates zu lenken, sondern Macht mit fester Hand zu ergreifen. Der Russe an sich, so Baranow, gewöhnt sich
und assimiliert sich an alles, frei nach dem Motto: Alles, was einen nicht umbringt, macht einen stärker.
Wie real der Roman in dieser Hinsicht ist, zeigt die Beschreibung der Begegnung von Baranow mit Prigoschin, der am 23./24. Juni 2023 mit seiner Wagner Gruppe den Marsch auf Moskau und damit den
Aufstand wagte. Zwei Monate später kann er bei einem ungeklärten Flugzeugabsturz um Leben. Es sei dabei darauf hingewiesen, dass der Roman vor diesen Ereignissen publiziert wurde. So, als hätte
Da Empoli das vorhergesehen!
Die unterschiedlichsten Situationsbeschreibungen, Einblicke in die Gedankenwelt der Protagonisten und die Gespräche verdeutlichen, wie wenig vorhersehbar dann letztendlich auch der Einmarsch in
die Ukraine war. Aber vor allem auch, dass ein Sturz Putins von innen heraus mehr als unwahrscheinlich ist. Die russische Elite vergisst die Opfer der Vergangenheit nicht, die Demütigungen, die
Armut. Deswegen folgen sie uneingeschränkt dem, der ihnen und dem russischen Volk, Weltmachtstreben, vermeintlichen Wohlstand und Perspektive zurückgibt. Aber auch eine gewisse Disziplin und
Ordnung sei nun zurück, zu ausschweifend und zügellos war manchen das simple Nacheifern westlichen Freiheitsdrangs.
Da Empoli erläutert auf zwei Erzählebenen, einerseits auf der des Literaturwissenschaftlers, andererseits auf der von Baranow, nachhaltig einem breiteren Publikum das Mysterium Putin, seinen
Aufstieg und seine Sicht auf die Welt. Da Empoli bildet durch eine Art „Schlüssellochblick“ einen teils neuen Blick auf die unmittelbare Umgebung von Putin und entmythologisiert das lange
vorherrschende Bild des „Lonely Cowboys“, der sich quasi selbst an die Spitze des ehemaligen Zarenreiches Reiches gehievt hat. Hierin liegt die wesentliche Leistung des Buches. Das Reich des
Zaren wurde aus dem Krieg geboren, und es war nun folgerichtig, dass es am Ende wieder zum Krieg zurückkehrte. Quasi nebenbei gibt er einen interessanten Einblick in die verborgene Privatsphäre
der Entourage des russischen Präsidenten und lieferte eine Beschreibung des russischen Systems aus Macht und Politik gleich mit. Putins Größe resultiert darin, die Fäden der russischen Geschichte
wieder aufgenommen, sie verknüpft und ihr Zusammenhalt gegeben zu haben.
✔ Fazit: Das Mysterium Putin, sein Aufstieg und seine Sicht auf die Welt als fiktiver Roman.
Andreas Pickel
★★★★★
4/5 von 5
© 2024 Andreas Pickel, Harald Kloth, Cover: Copyright © Verlag C.H. Beck
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Giuliano da Empoli: Der Magier im Kreml *Kindle bei amazon.de
*Taschenbuch bei amazon.de
*Hardcover bei amazon.de
Peter Longerich: Die Sportpalast-Rede 1943
Goebbels und der »totale Krieg«
München ; Siedler ; 2023 ; 208 Seiten ; ISBN 978-3-8275-0171-4

Die Herrschaft des proklamierten tausendjährigen Dritten
Reiches war bekanntermaßen bereits nach 12 Jahren beendet. Aber zwei Jahre vor ihrem Niedergang versuchte der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, in seiner zu
negativen Berühmtheit gelangten Sportpalastrede das deutsche Volk, Gesellschaft und Wirtschaft mental und in allen Konsequenzen auf den Krieg auszurichten, um so noch die Wende an den nach und
nach einbrechenden Fronten herbeizuführen. Eine akribische Analyse über Motive sowie Auswirkungen der Rede gibt der renommierte Historiker Peter Longerich in seinem Buch »Die Sportpalastrede
1943. Goebbels und der „totale Krieg“«.
Am 18. Februar 1943 hielt der Propagandaminister des NS-Regimes, Joseph Goebbels, vor Tausenden von begeisterten Zuschauern eine hochemotionale Rede, die er selbst als sein Meisterstück pries, um
die totale Mobilisierung aller Kräfte und Ressourcen für den Endsieg zu fordern. In kaum einer Dokumentation über das Dritte Reich, über die Wirkung von Propaganda, über die Beeinflussung von
Menschen, fehlen Ausschnitte dieser Rede, die in dem berühmt-berüchtigten Satz: „Wollt ihr den totalen Krieg“ kumulierte. Der Zeitpunkt der Rede war wohl ausgewählt. In Stalingrad kapitulierte
die 6. Armee, selbst der Kriegsheld Rommel musste nach und nach gewonnenes Terrain verloren geben und die Bomben der längst luftüberlegenen alliierten Luftstreitkräfte verbreiteten zunehmend
Furcht und Angst nun auch im Kerngebiet des Reiches.
Der renommierte Historiker und Professor Peter Longerich (u. a. Professor für moderne Geschichte am Royal Holloway College in London und Gründer des dortigen Holocaust Research Centers) kann mit
seinen bisherigen Forschungsschwerpunkten wie kein zweiter die Themen „Antisemitismus“ und „Nationalsozialismus“ auch für ein breiteres Publikum fachlich fundiert und verständlich erklären. Seine
Biografien über Hitler, Goebbels und Heinrich Himmler sowie sein Buch über die Wannseekonferenz fanden ebenso in
Historikerkreisen durchweg positive Resonanz.
Als der Krieg spätestens mit der Niederlage bei Stalingrad seinen Wendepunkt erreicht hatte (siehe Ian Kershaw:
»Wendepunkte«), begannen hinter dem Rücken von Hitler verstärkt Intrigenkämpfe seines engsten Zirkels um Macht, Einfluss und Gunst auf dessen Politik und Kriegsstrategie. Nachdem der Führer
selbst nicht gewillt war, so wie noch als Agitator in seiner Kampfphase vor der Machtergreifung, sich persönlich in seiner unnachahmlichen Art lautstark an die Volksgemeinschaft zu wenden, sprang
Goebbels gerne in die Bresche und hielt diese seit Wochen schon vorbereitete Ansprache. Vorbereitung dahingehend, dass Goebbels die Einführung einer Arbeitsdienstpflicht für Frauen, die
Ausrichtung der gesamten Industrie auf Kriegswirtschaft sowie die Schließung von Nobelgeschäften und -restaurants mit allem ihm möglichen Mitteln aktiv vorantrieb. Gerade Letzteres war auch gegen
seinen Rivalen Herman Göring gerichtet, der ein dekadentes Leben sehr schätzte. Goebbel’s Ziel war es, alles auf die Front und der Rüstung auszurichten. Im Gegensatz zu Parteigenossen wie eben
Göring, wollte Goebbels auch nicht „illusorisch“ sondern „nüchtern realistisch“ wirken, um sich damit populärer zu machen. Doch selbst Hitler war dem gegenüber skeptisch.
Am Rande sei erwähnt, dass Goebbels diese Rede in der Villa Bogensee (Nahe Wandlitz in Brandenburg) geschrieben hatte. Das dortige, ca. 17 ha große Areal, ist derzeit wieder in allen Medien, da
das mittlerweile stark marode Gebäude mit 30 Zimmern und sogar einem Kinosaal, nun mangels Kaufinteressenten sogar verschenkt werden soll, um es vor dem Abriss zu retten.
Absicht Goebbels war es, durch die Proklamation des totalen Krieges die Gefolgschaft für die Partei und des Staates zu bekräftigen oder vielmehr noch zu stärken sowie andererseits die
Überwachungsmöglichkeiten des totalitären Regimes bis auch in die letzten Winkel der Gesellschaft auszuweiten. Er orientierte sich dabei an dem 1935 erschienenen Buch „Der totale Krieg“ von Erich
Ludendorff, dem Stellvertreter von Paul von Hindenburg in der Obersten Heeresleitung und Ersten Generalquartiermeister im Ersten Weltkrieg. Ganz im Sinne des Mythos der Dolchstoßlegende über die
Schmach des Ersten Weltkrieges und des Versailler Vertrages, sei die Geschlossenheit des Volkes, so Ludendorff, der entscheidende Faktor über Sieg oder Niederlage und daran ist alles
einschließlich der Wirtschaft auszurichten.
Longerich seziert die Rede bis ins Detail, selbst die Reaktionen des Publikums werden wie „live“ wiedergegeben. Das Buch teilt sich in drei größere Kapitel, gibt die Rede vollständig wieder und
jeder Abschnitt der Rede (jeweils linke Seite) ist mit einem teils sehr ausführlichen Kommentar (jeweils rechte Seite) versehen. Im einleitenden ersten Teil des Buches schildert Longerich die
Ereignisse von Sommer 1942, als noch niemand an dem Endsieg zweifelte, bis zu den Einbrüchen im Frontverlauf Anfang 1943. Nach dem Mittelteil über die Rede an sich, beschäftigt sich dann der
abschließende dritte Teil mit den Auswirkungen und Reaktionen der Rede, hauptsächlich mittels einer Auswertung der in- und ausländischen Presse.
Der sorgsam ausgewählte Schauplatz der Veranstaltung war der symbolträchtige Sportpalast in Berlin-Schöneberg, da Goebbels hier im Gegenzug zu Außenveranstaltungen das gesamte Umfeld und alle
Umstände auf sich und seine Rede zuschneiden konnte. War der Sportpalast in den beginnenden 30er Jahren noch der Hort der Massenveranstaltungen der NSDAP, vereinnahmte Goebbels ihn später als
Schauplatz für seine eigenen Auftritte. Der Sportpalast war mittlerweile die größte nutzbare Halle in Berlin, da die noch größere Deutschlandhalle (errichtet für die Olympischen Spiele 1936) nach
Bombardierung nicht mehr nutzbar war.
Die Rede begann kurz nach 17:00 Uhr, dauerte insgesamt 109 Minuten und wurde zeitversetzt um 20:00 Uhr im Reichsrundfunk, in Ausschnitten auch im Ausland und mit Bildern unterlegt in der
Wochenschau übertragen. Durch diese Zeitversetzung konnte Goebbels, so Longerich, bei Bedarf noch Änderungen an dem Auftritt vornehmen, vor allem, was die Reaktion des Publikums betraf. Da
Goebbels das Live-Publikum teils handverlesen auswählte, waren wie in einem Theaterstück die Sprechchöre und Zwischenrufe drehbuchartig vorgeschrieben und inszeniert. Es war wie eine Art
Zwiegespräch zwischen den Live-Zuhörern und Goebbels, z.B. bei Erwähnung des Bündnispartners Japan wurde es lauter als bei dem zusehend in Kritik geratenen Kriegspartner Italien. Longerich nennt
das sehr treffend ein kongeniales Einverständnis zwischen Rednern und Publikum. Dies alle kumulierte dann in „10 Fragen“ mit dem Höhepunkt der 100%-igen lauthalsen Zustimmung zu „Wollt ihr den
totalen Krieg“, gleichzusetzen mit 100% Ja-Stimmen bei einer Wahl.
Goebbels, so der Autor, setzt in seiner Rede oft in „pathetisch-feierlicher Tonlage“ auf die bewährten Themen der Nationalsozialisten wie Rassismus, den Gefahren des Bolschewismus und des
Judentums. Diese verbindet er dramaturgisch gekonnt mit Angst schürenden Meldungen, Gefahren für das Deutsche Reich seien imminent und nur ein totaler Krieg verkürze den Krieg. „Friss“ (… den
totalen Krieg) oder „Stirb“, also Untergang mit allen Racheakten der Alliierten, so der Appell Goebbels. Auch ganz im Sinne der Eliten des NS-Regimes spielt er auf den „notwendigen“, gerade auf
den traurigen Höhepunkt zulaufenden Genozid an den Juden an, ohne diesen explizit zu erwähnen (er spricht von „Ausschaltung“!). Goebbels, so Longerich, wollte damit die Bevölkerung bewusst nicht
nur zu Mitwissern sondern zu Komplizen der unvorstellbaren Verbrechen machen.
In seinem gesonderten langen Appell an die Frauen, sich stärker in der Kriegsindustrie zugunsten von somit freigesetzter Männerkraft als Soldaten zu engagieren konterkariert Goebbels sogar sein
eigenes Verhalten, unterhielt er doch drei große Haushalte und einige weitere kleinere Unterkünfte mit entsprechend großer Entourage an Bediensteten, die ja ebenso der Kriegswirtschaft entzogen
waren. Der Spruch „Wasser predigen und Wein trinken“ passt nirgends besser.
Aber, so das Resümee des Historikers, Goebbels war nur bedingt erfolgreich, seine Ziele zu erreichen. Die Absichten Aufbruch zu erzeugen, den „totalen Krieg“ allgegenwärtig zu machen, die
Gefahren des Bolschewismus im In- und Ausland sowie die Gefahr dessen Vereinigung mit dem „terroristischen Judentum“ noch stärker ins Bewusstsein zu rücken und sich selbst neben Hitler als DIE
Instanz des Dritten Reiches zu inthronisieren missglückten größtenteils. Ihm gelingt es eben nicht, das Volk komplett zu verführen, von nun an die Stimme des Volkes in allem zu kontrollieren, für
seine Absichten zu instrumentalisieren und ihm und damit auch dem Führer ohne „wenn und aber“ bedingungslos zu folgen.
Die ganzen Umstände um die Rede und der Auftritt an sich unterstreichen den Narzissmus und den Größenwahn Goebbels, der sich selbst eine fantastische und exzellente Rede attestierte und das noch
Tage und Wochen danach. Er war also sein eigener größter Fan! Dabei unterschätzte er insbesondere die negative internationale Reaktion auf seine Rede. Erst im weiteren Verlauf des Frühjahrs 1943
wurde Goebbels zunehmend bewusst, dass seine Absichten für die Umsetzung eines „totalen Krieges“ auf allen Ebenen bezweifelt wurden. So kam es eben nicht zu einer Frauenarbeitsdienstpflicht,
Spielbanken wurden wiedereröffnet und auch Beschränkungen im Reiseverkehr erneut aufgehoben.
Am Beispiel dieser Rede und seinen Auswirkungen zeigt sich auch, wie in einem Regime, dass unterhalb von Hitler als Leitinstanz wie in einer Polykratie von mehreren Machtsäulen getragen wurde,
die miteinander verzahnt waren, aber sich nicht selten bekämpften, die auch vielen Rivalitäten und inneren Konflikten ausgesetzt waren. Für Goebbels sollte die Rede das entscheidende Vehikel
nicht nur für die Gunst des Volkes, sondern auch und insbesondere um die von Hitler werden. Das Vorhaben scheiterte!
Historikern wie Longerich ist es zu verdanken, dass wir mittlerweile eine Erinnerungskultur an die dunkelste Zeit Deutscher Geschichte haben, die frei von Klischees ist. Er schafft es die außen- und innenpolitischen Rahmenbedingungen auf aktueller Forschungslage auf den Punkt gebracht
zusammenzufassen. Und am Ende die kurz- und mittelfristigen Folgen der Rede aufzeigend, auch die egoistischen Profilierungsabsichten Goebbels zu verdeutlichen. Das etwas unübersichtliche
Nebeneinander von originalem Redetext und den Kommentaren sowohl in deren Länge wie auch Tiefe ist dabei vernachlässigbar.
✔ Fazit: Auch wenn Longerich nichts grundsätzlich Neues präsentiert, ist das vorliegende Werk eine glänzende Hintergrundanalyse und zusammenfassende Darstellung eines der größten Propagandaevents der Historie.
Andreas Pickel
★★★★
4 von 5
© 2024 Andreas Pickel, Harald Kloth, Cover: Copyright © Siedler Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Peter Longerich: Die Sportpalast-Rede 1943 *Hardcover bei amazon.de
*Kindle bei amazon.de
Sløborn
2019 - 2023
3 Staffeln
Auf der (fiktiven) Insel Sløborn, nahe der dänischen Grenze, lebt die Teenagerin Evelin (Emily Kusche) mit ihren drei Brüdern und Eltern. Neben den vielen Touristen, die sich auf der malerischen Insel aufhalten, haben die Einwohner ihre typischen Alltagssorgen.
Da ist die toughe Hauptprotagonistin Evelin, schwanger von ihrem Lehrer. Die Eltern stehen vor der Trennung, der Vater (Wotan Wilke Möhring) will als Tierarzt die Insel verlassen, um in die Forschung zu gehen. Hermann (Adrian Grünewald) ist das typische Mobbingopfer in der Schule. Von seinem Vater wird er geliebt, aber auch geschlagen. Dieser hat als Ortspolizist seine sehr eigene Art, Probleme zu lösen. Der exzentrische und drogensüchtige Schriftsteller Nikolai Wagner (Alexander Scheer) wird zu einer Lesung auf die Insel eingeladen. Die ihn vergötternde, örtliche Buchhändlerin zwingt ihn zum Entzug. Schließlich ist da noch Ex-Sträfling Magnus (Roland Møller), der zusammen mit Sozialarbeiterin Freya eine Gruppe straffällig gewordener Jugendlicher zur Resozialisierung auf das Eiland bringt.
Alles ändert sich, als ein Boot strandet. An Bord: ein totes Ehepaar, das an der weltweit grassierenden Taubengrippe gestorben ist.
In Staffel Eins steht die Vorstellung der Hauptfigur Evelin und der zahlreichen Nebenfiguren, sowie des Inselschauplatzes im Vordergrund. Durch die sehr langsame Zuspitzung der Ereignisse ist die erste Staffel überzeugend, auch weil die Figuren interessant sind und sich weiterentwickeln. Die hereinbrechende Katastrophe wird in der Panik und Überforderung der Menschen spannend dargestellt. Die erste Staffel ist ein spannender Viren-Thriller in Serienform, fast wie in klassischen Katastrophenfilmen.
In Staffel Zwei versuchen die wenigen verbliebenden Gruppen mit ihrem neuen Leben auf der Insel klarzukommen. Verzweifelt versucht Freja ihre „Kinder" zur Teamarbeit zu motivieren und etwas Hoffnung zu bieten. Auch Evelins Geburtstermin rückt immer näher, was eine dramatische Entscheidung erfordert. Die zweite Staffel zeigt eine Postapokalypse, in der Konflikte in den verschiedenen Gruppierungen ausbrechen und der Kampf um Ressourcen beginnt.
In Staffel Drei sind die Gruppen auf Husum angekommen. Dort kämpfen sie gemeinsam mit Überlebenden des Krankenhauses mit einer gewalttätigen Bande. Sie schaffen es, eine Windkraftanlage in Betrieb zu nehmen und die Stadt mit Strom zu versorgen. Die Suche nach ihrem Vater führt Evelin in ein beängstigendes Camp. Die dritte Staffel versucht die Serienwelt enorm zu weiten. Es ist die actionlastigste und für mich enttäuschendste Staffel (manches erinnert sogar ein klein wenig an »Mad Max«, der Panzer etwas an »The Walking Dead«). Leider führen für mich nicht alle Erzählstränge zu einem befriedigenden Ende. Eine vierte Staffel wäre wohl sinnvoll gewesen.
Gruselig an »Sløborn« ist die Voraussicht von Christian Alvart (»Oderbruch«, »Freies Land«, »Pandorum«), der die Fernsehserie weit vor der realen COVID-19-Pandemie recherchiert und geschrieben hat. Die Parallelen sind bis zu einem gewissen Grad erschreckend. Auch wenn die fiktive „Taubengrippe" in der Serie viel extremere Auswirkungen auf die menschliche Gesellschaft hat, da die Totesrate unter den Erwachsenen erheblich ist. Das erinnert an den deutschen Fernsehfilm »Leere Welt« (1987, von Wolfgang Panzer, nach dem Buch von John Christopher) oder die italienische Fernsehserie »Anna« (2021). So gab es drei Möglichkeiten diese Serie zu sehen: Vor, während und nach der realen Pandemie. Dementsprechend unterschiedlich wirken die Bilder dann auch auf die Betrachter. Vieles was uns vor der COVID-19-Pandemie als unrealistisch erschien, ist mit dem jetzigen Erfahrungsschatz in das gesellschaftliche Gedächtnis eingesickert. So waren im März 2020 die Krankenhäuser in New York City völlig überlastet, apokalyptisch wirkende Bilder gingen um die Welt. Wenn in der Serie Evelin in das Krankenhaus nach Kiel gebracht wird, wirkt das heute nicht mehr so übertrieben. Auch die Aufforderung an die Inselbewohner nicht zu einer Beerdigung zu gehen, war in Deutschland Anfang 2020 durch strenge Auflagen geregelt.
Natürlich kann man einige Klischees und Unlogiken auch in dieser Serie finden - was soll´s! Christian Alvart zeigt mit einem hervorragenden Cast, dass gute Genrekost aus deutschen Landen möglich ist. Eine Serie, die sich hinter vergleichbaren internationalen Produktionen nicht zu verstecken braucht.
Leonine Studios veröffentlichte diese Fernsehserie auf DVD und Blu-ray. Die erste Staffel wurde im Juli 2020, die zweite Staffel im März 2022 veröffentlicht.
Fazit: Eine starke Heldin kämpft in einer zunehmend dystopischen Welt um ihre Familie. Spannender Mix aus Science-Fiction-Drama, Katastrophen- und Coming-of-Age-Film.
Harald Kloth

© 2024 Harald Kloth
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Sløborn - Staffel 1 *DVDs bei amazon.de
*Blu-rays bei amazon.de
Sløborn - Staffel 2 *DVDs bei amazon.de
*Blu-rays bei amazon.de
Sløborn - Staffel 3 *DVDs bei amazon.de
*Blu-rays bei amazon.de
Jared Muralt: The Fall
Band 1
Bern ; Tintenkilby ; 2019 ; 64 Seiten ; ISBN 978-3-906828-34-3
Die Welt ist am Arsch. Klimakatastrophe, Weltwirtschaftskrise, Bürgerkriege und eine Pandemie brechen über die Gesellschaft herein. Mittendrin ist Familienvater Liam, der gerade arbeitslos geworden ist. Mit seiner halbwüchsigen Tochter Sophia und deren Bruder Max grillt er im Garten, als Kampfflugzeuge über die Stadt donnern. Mutter Marie arbeitet im Krankenhaus (man wird sie nie sehen) und erkrankt an der gefährlichen „Sommergrippe". Nach einem Anruf versucht die Familie vergeblich zur Mutter zu gelangen. Die öffentliche Ordnung bricht zusammen, Supermärkte werden geplündert. Auch ein Entkommen aus der Quarantänezone ist schließlich nicht mehr möglich.
Wow! Der schweizer Autor Jared Muralt präsentiert in seinem Erstlingswerk eine grandios gezeichnete Dystopie. Mit feinem Strich und sehr detailliert gezeichnet, könnte die Geschichte in jeder europäischen Stadt spielen. In Details erkennt man die Schweiz. Muralt läßt die Katastrophe eher langsam über die Familie hereinbrechen. Umso schockierender wirken dann grausame Details, wie erschossene Demonstranten oder Grippetote auf Lastwagen (erinnert sich noch wer an die Militärlastwagen mit Toten in Bergamo im März 2020?).
Der in Bern geborene Muralt veröffentlichte diesen ersten Band seiner mehrbändig angelegten Comicreihe bereits 2018. Damit sagte er (ebenso wie Christian Alvart´s Virenthrillerserie »Sløborn«) die COVID-19-Pandemie (die von 2020 bis 2023 weltweit wütete) auf gruselige Weise medial voraus. Den Vergleich mit Comics wie »The Walking Dead«, »Virus Omega«, »The Green Class« oder der auf ein dutzend Bände angewachsenen »Zombie-Reihe« von Olivier Peru muß die Schweizer Variante auf keinen Fall fürchten. Ganz im Gegenteil, denn diese Version ist viel realistischer, weniger actionhaft, dafür aber viel näher dran am Leid der Figuren.
Band Eins von »The Fall« enthält die Kapitel »1: Am Ende des Traums«, »2: Zone B« und »3: Mr. Lewis«. Als Bonus enthält dieser Softcoverband 11 Seiten mit Cover-Illustrationen und Bleistiftvorzeichnungen.
✔ Fazit: Tolles Comic-Debüt. Eine Familie in der Apokalypse.
Harald Kloth
★★★★★
4/5 von 5
Band 2
Bern ; Tintenkilby ; 2022 ; 84 Seiten ; ISBN 978-3-906828-32-9
Band Zwei von »The Fall« enthält die Kapitel »4: Der erste Schnee«, »5: Asylum« und »6: Le Soldat de M.P.C.«. Als Bonus enthält dieser Softcoverband 2 Seiten mit Bleistiftvorzeichnungen.
Band 3
Bern ; Tintenkilby ; 2022 ; 96 Seiten ; ISBN 978-3-906828-35-0
Band Drei von »The Fall« enthält die Kapitel »7: Das Haus am See« und »8: Dunkle Wasser«. Als Bonus enthält dieser Softcoverband zwei Seiten mit Cover-Illustrationen und vier Seiten mit Konzeptskizzen.
© 2024 Harald Kloth
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Jared Muralt: The Fall, Band 1 *Taschenbuch bei amazon.de
Band 2 *Taschenbuch bei amazon.de
Band 3 *Taschenbuch bei amazon.de
Christian Keßler: Bleigewitter über Cinecittá
Gangster und Polizisten im italienischen Kino von 1960-1984
Berlin ; Martin Schmitz Verlag ; 2023 ; 360 Seiten ; ISBN 978-3-927795-99-0

Es gibt Bücher, die man sofort als Standardwerk identifizieren kann. »Bleigewitter über Cinecittá - Gangster und Polizisten im italienischen Kino von 1960-1984« von Christian Keßler ist solch ein Glücksfall.
Vom unspektakulären grünen Hardcovereinband sollte man sich nicht abschrecken lassen. Der Filmjournalist führt durch drei Jahrzehnte italienische Filmgeschichte. Er bespricht 219 (!) Kriminalfilme mit Schwerpunkt der 1970er Jahre. Die Poliziottesco oder auch Poliziotteschi genannten Streifen bilden im Polizeifilm ein eigenes Untergenre. Diese Kriminal- und Gangsterfilme sind aus heutiger Sicht oft kontrovers, politisch unkorrekt, überaus gewalttätig und machten - im wahrsten Sinne des Wortes - keine Gefangenen. Dass diese Streifen Jahrzehnte nach ihrem Erscheinen von Filmliebhabern wiederentdeckt werden, ist ein echtes Phänomen. Aber manchmal ist der Weg vom Schund zur Filmperle ein kurzer. Dem Autor gebührt jedenfalls großen Dank, sich diesem Nischenthema des Kinos ausführlich mit außerordentlich viel Wissen und sarkastischen Witz gewidmet zu haben.
Nach seinem gelungenen Ausflug ins Giallo-Kino »Gelb wie die Nacht - Das italienische Thrillerkino von 1963 bis heute« (2020) ist dies die perfekte Ergänzung für Freunde des italienischen Genrekinos. Kesslers Texte sind prägnant und bringen enormes filmhistorisches Wissen, teils auch gesellschaftspolitischen Kontext mit. Im Gegensatz zum vorherigen (gelben) Buch ist der Stil nun aber weit weniger flapsig und zynisch. Für Filmfans gibt es trotzdem jeden Menge ikonischer Sätze wie: „... in dem Silva rot sieht und mit seinen Eiern Wände einebnet, wird mit Stockhieben bestraft.“ (Seite 162, In den Händen des Entführers) oder „Wer seine Weg kreuzt und auch nur einen Pups absondert, ist des Todes.“ (Seite 239, Stadt in Panik). Wer bei derlei Sätzen nicht vor Freude mit der Zunge schnalzt oder lachend in der Ecke liegt, sollte sich aber vielleicht lieber seriöseren Genres zuwenden. Zu jedem Film gibt es mindestens eine farbige Abbildung des Filmplakats und einige wenige Aushangfotos. Wirklich wichtig ist das Titelregister am Ende, durchsuchbar nach deutschen Filmtiteln und italienischen Originaltiteln. Ein Personenregister fehlt leider.
✔ Fazit: Wer bisher noch nichts von Umberto Lenzi, Damiano Damiani, Andrea Bianchi, Tomas Milian, Maurizio
Merli, Fabio Testi oder Henry Silva gehört hat, sollte dieses Buch möglicherweise nicht kaufen. Wer aber eine Zeitreise mit miesen Kriminellen, brutalen Vigilanten und unorthodoxen Polizisten
erleben möchte, ist hier genau richtig.
Harald Kloth
★★★★★
5 von 5
© 2024 Harald Kloth, Cover: Copyright © Martin Schmitz Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Christian Keßler: Bleigewitter über Cinecittá *Hardcover bei amazon.de
Startseite → Sachbücher → Film
Petra Bartoli y Eckert: In den Bergen findest du zu dir
Abenteuer Alpenüberquerung. Was wir beim Wandern über Resilienz lernen
München ; Kösel-Verlag ; 2023 ; 224 Seiten ; ISBN 978-3-641-30394-5

Resilienz – innere und äußere Widerstandskraft. Den Anforderungen des Lebens beweglich wie eine Feder gegenübertreten. Kann uns eine Alpenüberquerung und die damit verbundene Auseinandersetzung mit unseren eigenen Schwächen stärken? Und unsere Stärken fördern? Falls ja wie? Wann ist der richtige Moment, auch einmal die Entscheidung zur Umkehr zu treffen oder eine andere Route zu wählen?
Nach monatelangen Vorbereitungen, mit Touren im Bayerischen Wald und in den Bayerischen Alpen, nimmt uns Petra Bartoli y Eckert mit, auf ihrem spannenden Weg über die Alpen, der verbunden ist mit allerlei Strapazen und manchmal auch dem Kampf gegen den „inneren Schweinehund“. Aber auch geprägt ist durch Begegnungen und den Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen und ihren bewegenden Geschichten und Biografien.
Welche Umstände, Tatsachen, Begleiterscheinungen haben diese Menschen in die Berge geführt? Wodurch sehen sie sich durch Ihre Verbindung zu den Alpen und zum Wandern in ihrer eigenen
Widerstandsfähigkeit gestärkt? Mit dieser interessanten Frage in ihrem Rucksack, machte sich die Autorin zu Fuß auf den Weg, auf der Suche nach Antworten.
Es begann eine mehrwöchige, spannende, lehr- und abwechslungsreiche, aber auch anstrengende Wanderung über die Alpen. Die Autorin traf sich mit, von Ihr im Vorfeld sorgfältig ausgewählten
Menschen, die vielleicht Antworten auf Ihre Fragen geben könnten. Aber gerade auch die zufälligen Begegnungen auf dem Weg mit Menschen, die nach dem ersten Gesamteindruck der Autorin verstanden
haben könnten, wie wir unsere innere und äußere Widerstandskraft trainieren, verbessern und erhalten können, machen die „Gesamtessenz“ des Werkes aus.
Das jeweilige Umfeld, Lebenssituationen, Erfahrungen, Beruf etc. der Befragten, schenken dem Leser eine Vielfalt an interessanten Perspektiven und Meinungen. Egal ob ein Almhelfer, eine
Chefdirigentin, ein Speedkletterer, eine Bergführerin und Psychologin, eine Kunsttherapeutin, eine Rettungshundeführerin befragt wurden, der Spannungsbogen zieht sich durch alle Interviews im
Buch. Die Palette der Meinungen bildet einen Schatzkiste voller Fundstücke, welche nicht abwechslungsreicher gefüllt sein könnte. Eines haben all diese Menschen gemeinsam: Sie haben die positive
Energie und Wirkung des Wanderns, der Berge, der Natur entdeckt.
Die einzelnen Interviews sind so abwechslungsreich und so flüssig lesbar verfasst, dass an keiner Stelle des Buches Langeweile aufkommt. Im Gegenteil, man möchte die Literatur gar nicht aus der
Hand legen, weil die einzelnen Biografien und die Betrachtungsweisen der Menschen so fesselnd verfasst und wiedergegeben sind.
Interessante Überschriften umrahmen jede einzelne der Geschichten und laden Schritt für Schritt zum Weiterlesen ein.
✔ Fazit: Eine äußerst kurzweilige, spannende, nachdenkliche und informative Reise auf der Suche nach dem
richtigen und passenden Impuls für noch mehr innere Widerstandsfähigkeit auf der Suche zu Dir selbst.
Jutta Kloth
★★★★★
5 von 5
© 2024 Jutta Kloth, Harald Kloth, Cover: Copyright © Kösel-Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Petra Bartoli y Eckert: In den Bergen findest du zu dir *Taschenbuch bei amazon.de
*Kindle bei amazon.de
Startseite → Sachbuch → Reise
Conny from the block: Da bin ick nicht zuständig, Mausi
Nix Neues vom Amt
München ; dtv ; 2023 ; ISBN 978-3-423-21878-8 ; 288 Seiten

Conny hat eine steile Karriere gemacht: sie hockt seit gefühlt Jahrzehnten mit einigen anderen ebenfalls mehr oder weniger motivierten, engagierten und frustrierten KollegInnen „uffm Amt“ und
kämpft tagtäglich in diesem sich selbst erhaltenden Behördenapparat, der ja schließlich verdient mit Vehemenz und aller zur Verfügung stehenden Kraft gegen jedwede Änderung, Verbesserung oder gar
Innovation unter allen Umständen verteidigt werden muss, einen aussichtslosen Kampf.
Gemeinsam mit (oder auch gegen) ihren wohl oder übel zu Freundinnen und Familie gewordenen Kolleginnen „Tief-einatmen Petra“, „Kussi-Doris“, „Küken-Dilara“, „Gegen-alles-Gisela“ und Chefin
„Change-Management-und-Anlizismen-Ronja“, trotzt sie in ihrem zum Universum gewordenen Mikro-Kosmos „Abteilung“ tagtäglich Aktenbergen, Neuerungen, Management-Geschwafel, der mittlerweile sogar
den Amtsstuben drohenden Digitalisierung und vor allem dem größten Feind einer jeden Amtsstube: den Bürgerinnen und Bürgern, die teilweise selbstbewusst, fordernd oder sogar frech ihr Recht
einfordern. „Soweit kommt´s noch, nicht mit mir. Punkt!“
Aber es wird im allseits bekannten, sich trotz Bürokratieabbau sich immer mehr aufblähenden Behördenwahnsinn auch mal was erledigt, was wichtiges in die Zwischenablage umgeschichtet, zwischen
Rauch- und Kaffeepausen, der neueste Klatsch verbreitet, gestritten, gelästert, geflirtet, rumgezickt und der Flurfunk am Laufen gehalten.
Esra Dulmen alias Conny from the Block gelingt mit ihrem satirischen Blick in den Behörden-Wahnsinn ein absolut kurzweiliges, unterhaltsames Buch, denn wer hat sich nicht schon irgendwann mal
gefragt: was für Menschen arbeiten eigentlich in Behörden? Auf wunderbar ehrliche und überspitzte Art und Weise werden wir hier mit der harten Wahrheit konfrontiert: es sind ganz normale Menschen
mit allerlei Problemen und Vorurteilen, mit Angst vor jeglichem Fortschritt und Veränderung, wenig sozialer Kompetenz, ganz einfach Menschen wie du und ich!
✔ Fazit: Change-Ronja würde sagen: Ditte is een „must read“ oder watt!
Wolfgang Gonsch
★★★★
4 von 5
© 2023 Wolfgang Gonsch, Harald Kloth, Cover: Copyright © dtv Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Conny from the block: Da bin ick nicht zuständig, Mausi! *Taschenbuch bei amazon.de
*Kindle bei amazon.de
Dune - Die offizielle Graphic Novel zum Film
Text von Lilah Sturges. Illustriert von Drew Johnson
Bielefeld ; Splitter ; 2023 ; ISBN 978-3-98721-275-8 ; 136 Seiten ; Hardcover

Die Neuverfilmung des Romans »Dune« im Jahr 2021 durch den Regisseur Denis Villeneuve (»Sicario«, »Arrival«, »Blade Runner 2049«) zeigte eindrucksvoll wie gut Literaturverfilmungen sein können. Der Kanadier adaptierte den ersten Teil des gleichnamigen Romans von Frank Herbert aus dem Jahr 1965 sehr erfolgreich und schuf einen modernen Klassiker des Science-Fiction-Films.
Der Splitter-Verlag hat »Dune« bereits als Graphic Novel in zwei Bänden veröffentlicht. Der Roman wurde hierfür von Brian Herbert und Kevin J. Anderson adaptiert. Neben drei Bänden zum Haus Atreides und ebensoviel (geplanten) zum Haus Harkonnen und anderen Veröffentlichungen, folgt nun die offizielle Graphic Novel zum Film. Diese Adaption basiert somit auf der Verfilmung und nicht direkt auf dem Ursprungswerk.
Zeichnerisch unterscheiden sich die Panels von Drew Johnson stark von den bereits erhältlichen Werken (»Buch 1« und »Buch 2: Muad`Dib«) gleichen Inhalts. Atmosphärisch gelingt Johnson die Umsetzung extrem gut. Nebel-, Schatten- und Lichteffekte visualisieren großartig die unterschiedlichen Schauplätze: Die dunklen Gemächer auf Caladan, die sengende Hitze auf Arrakis oder das gedimmte Licht im Inneren eines Ornithopters. Gut sind auch die Gesichter und die Augen gezeichnet. Manchmal sind Gesichtspartien bei Comics problematisch. Doch hier wirken sie zum filmischen Pendant stimmig, die Schauspieler sind sofort wiederzuerkennen.
Überrraschend gut gelingt die Komprimierung dieser Romansaga um Herrscherhäuser und Intrigen in einem intergalaktischen Imperium auf nur 114 Seiten. »Dune - Buch 1« (Herbert/Anderson/Allén/Martín) brauchte hierfür immerhin 173 Seiten. Ein Vergleich beider Werke lohnt sich, jedes ist auf seine Art eine tiefe Verbeugung vor Frank Herbert´s »Dune«.
Das Cover der regulären Ausgabe wurde von Bill Sienkiewicz (»Elektra«) gestaltet. Der Comic ist auch als limitierte Vorzugsausgabe (1.000 Exemplare) mit Variantcover des malaysischen Künstlers Zid und exklusivem Kunstdruck von Bill Sienkiewicz erhältlich. Auf 32 mal 23 Zentimeter Größe ist diesem wunderbaren Werk auch eine Charaktergalerie von Bill Sienkiewicz angehängt. Ebenso verschiedene Variantcover von Zid, Drew Johnson, John Ridgway und Tim Sale.
✔ Fazit: Der Kwisatz Haderach erwacht! Eine Comicadaption wie ein Gemälde. Ein herausragender
Dune-Comic.
Harald Kloth
★★★★★
5 von 5
© 2023 Harald Kloth, Cover: Copyright © Splitter Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Dune - Die offizielle Graphic Novel *Hardcover bei amazon.de
Brisson/Walker: Predator 1 - Tag des Jägers
Story: Ed Brisson. Zeichnungen: Kev Walker
Stuttgart ; Panini ; 2023 ; 164 Seiten ; ISBN 978-3-7416-3606-6

Das Jahr 2041. Die Company Astar Industries entsendet Siedler zum Planeten Damara. Dort tötet ein Predator alle Frauen und Männer. Einzig das Kind Theta überlebt.
Das Jahr 2056. Aus der kleinen Theta ist eine junge Frau und brutaler Racheengel geworden. Ihr einziger Lebenszweck: Den Predator zu erlegen, die ihre Familie umgebracht hat. Mit dem gestohlenen Companyschiff Sandpiper und dem, zum Freund gewordenen, Bordcomputer Sandy reist sie auf der Suche nach den Predatoren durch das All. Als Vorräte und Ersatzteile zur Neige gehen, muss Theta auf dem Eisplaneten Tusket notlanden. Doch dort wird sie schon erwartet ...
Neben »Alien/s« ist »Predator« ein weiteres großes Science Fiction-Franchise der Filmproduktionsgesellschaft 20th Century Studios. Der Schwarzenegger-Streifen von 1987 zog bisher vier Fortsetzungen und zwei (Alien)-Crossover unterschiedlicher Qualität nach sich. Desweiteren Games, Romane und Comics. Vorliegender Comic »Predator 1 - Tag des Jägers« umfasst die sechs Hefte »Day of the Hunter Part 1 - 6«.
Grafisch ist dieser Band nur durchschnittlich. Die Licht- und Schatteneffekte sind oft gut gelungen. Ebenso sind die Action- und Kampfsequenzen sehr dynamisch. Aber die Figuren könnten viel detailreicher gezeichnet sein. Und auch einfarbige Hintergründe wirken in den Panels manchmal langweilig.
Die Zukunftstechnik ist stimmig, manches erinnert auch an die SciFi-Serie »Sillage«. So etwa die fremdartigen Aliens, die von einem Predator massakriert wurden oder das Hoverbike, mit dem Theta unterwegs ist. Schwierig ist der Charakter Theta. Das Mädchen ist ein getriebener, seelisch und körperlich verwundeter Mensch. Immer an der Grenze zur Selbstzerstörung. Dass ein Mensch aber über 20 Predatoren erlegt hat, ist eine recht unglaubwürdige Storyline. Denn das nimmt viel von der Gefährlichkeit dieser Jäger, sie werden austauschbar. Damit geht viel Reiz diese Mythos verloren.
Positiv hervorzuheben ist eine zwölfseitige Galerie mit teils hervorragenden Variant-Covern.
✔ Fazit: Actionreiches Rachespektakel im Predator-Universum. Die Jäger werden zu Gejagten.
Harald Kloth
★★★
3 von 5
Predator
Band 1: Tag des Jägers | Band 2: Das Reservat | Predator 3: Die letzte Jagd
© 2023 Harald Kloth, Cover: Copyright © Panini Verlags GmbH
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Ed Brisson/Kev Walker: Predator 1 - Tag des Jägers *Taschenbuch bei amazon.de
Stephen King: Fairy Tale
Gelesen von David Nathan
4 mp3-CDs, Gesamtspielzeit: ca. 26 Stunden 47 Minuten
München ; Penguin Random House ; 2022 ; ISBN 978-3-8371-6041-3

Der 17jährige Charlie rettet einem Nachbarn, Mister Bowditch, das Leben. Fortan fühlt er sich verpflichtet den, als verschroben und sonderlich geltenden, Mann zu unterstützen. Er kümmert sich insbesondere liebevoll um dessen alten Schäferhund Radar, aber auch um Haus und den Garten. In einem verschlossenen Gartenhäuschen stößt Charlie auf ein schier unglaubliches Geheimnis. Eine Pforte führt ihn in eine fremde Märchenwelt, genannt Empis.
In Empis trifft Charlie auf die Schuhmacherin Dora und erfährt von dem Fluch, der über dem Königreich liegt. Die meisten Menschen leiden unter furchtbaren Entstellungen, sie werden „Die Grauen" genannt. Die Nachtsoldaten und der grausame Herrscher „Flugtöter" knechten das Land. Charlie begibt sich in die Stadt Lilimar um einen Jungbrunnen in Form einer Uhr zu finden und so den Hund Radar zu retten. Doch Lilimar ist ein gefährlicher Or. Und Prinz Charlie, wie er bald genannt wird, trifft auf neue Freunde und Feinde. Und dann ist da natürlich auch noch die schöne Prinzessin Leah ...
Nein, ein schlechter King-Roman ist »Fairy Tale« beileibe nicht. Die Figuren sind nur leider klischeehaft. Das fängt mit dem kantenlosen Vorzeigejugendlichen Charlie an. Und geht weiter mit den oft langweiligen Märchenfiguren: Prinzessin Leah, Meerjungfrauen, Riesen oder sprechende Rieseninsekten. So gefiel mir die Erzählung um Charlie´s reale Welt besser, als die Abenteuer in der Anderswelt Empis. Vielleicht hätte King einfach noch mehr auf Humor setzen sollen.
Trotzdem ist »Fairy Tale« ein kurweiliges Märchenabenteuer, bei dem man gerne bis zum Ende zuhört. Der Vorleser David Nathan gehört ohne Zweifel zu den Besten seines Faches. Spannend war für mich, wie King den Schluß gestaltet. Bleibt Charlie in Empis und bekommt er die Prinzessin? Was ist mit seinem alkoholkranken Vater? Wird der Hund Radar durch die Verjüngung auf der Sonnenuhr Schaden nehmen? Und wird sich das Königreich wieder erholen? Werden weiter Personen die Anderswelt besuchen?
✔ Fazit: Düstere Märchenstunde mit Stephen King und David Nathan.
Harald Kloth
★★★★
3/4 von 5
© 2023 Harald Kloth, Cover: Copyright © Penguin Random House Verlagsgruppe
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Stephen King: Fairy Tale *Audio-CD bei amazon.de
*Taschenbuch bei amazon.de
*Hardcover bei amazon.de
*Kindle bei amazon.de
Michael Ostrowski: Der Onkel
Roman
Hamburg ; Rowohlt ; 2022 ; 320 Seiten ; ISBN 978-3-498-00329-6

Irgendwie merkwürdig, irgendwie lässt einen dieses Buch dann doch ein bisserl ratlos zurück, irgendwie zumindest. Schauspieler und Teilzeit-Kabarettist Michael Ostrowski (im deutschen, besser
süddeutschen, Raum bekannt als Pathologe bei den Eberhofer-Filmen oder als Privatdetektiv in den Passau-Krimis) legt mit »Der Onkel« seinen ersten Roman vor. Zuvor hat er die Geschichte, in der er selbst die Rolle seiner Hauptfigur spielt, in seiner Heimat
Österreich ins Kino gebracht –
flankiert von seinen Schauspielkollegen Anke Engelke, seiner Lebensgefährtin Hilde Dalik und Simon Schwarz. Der gebürtige Steirer mit dem Wiener Schmäh macht halt alles ein bisserl anders, irgendwie.
Und darum geht’s: Der verschollen geglaubte Lebemann Mike Bittini erfährt, dass sein Bruder – ein erfolgreicher Immobilienanwalt – ins Koma gefallen ist. Er kehrt zurück zu dessen Familie,
schleicht sich dort ein wie der Habicht in den Hühnerstall und mischt alle und alles ordentlich auf. Der Onkel kommt um zu helfen, erzeugt aber Chaos und findet schlußendlich die Liebe.
Der Roman besticht durch seinen immer weitertreibenden Schreibstil, passend zu Protagonist Mike – einem Lauser, ein Gauner, einem absoluten Antihelden, der in der Geschichte selbst ein
Getriebener ist. Ostrowski erzählt sein schräges, oft witziges aber manchmal stark überzogenes Gschichterl in schönster österreichischer Sprache, die man eigentlich nur mit dem wunderbaren Wort
„Schmäh“ beschreiben kann. Glücklich seien hier jene, die diesen Roman (so wie ich) auf östereichisch lesen können, dann zündet der Plot so richtig, das Ende jedoch lässt aber dann doch Fragen
offen, irgendwie.
Fazit: „Der Onkel“ - herrlich schräg mit Wiener „Schmäh“ – irgendwie …
Wolfgang Gonsch
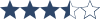
© 2023 Wolfgang Gonsch, Harald Kloth, Cover: Copyright © Rowohlt Verlag
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Michael Ostrowski: Der Onkel *Taschenbuch bei amazon.de
*Hardcover bei amazon.de
*Kindle bei amazon.de
Benjamin Lahusen: Der Dienstbetrieb ist nicht gestört
Die Deutschen und ihre Justiz 1943 - 1948
München ; C.H. Beck ; 2022 ; 384 Seiten ; ISBN 978-3-406-79026-3
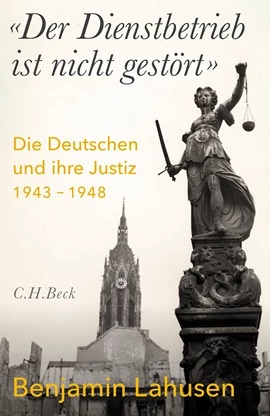
Am 24. Februar 2022 startete Russland seine als „Spezialoperation“ titulierte Invasion in die Ukraine. „Das Recht als System kann solche Vorgänge verdrängen ... Ein Mensch kann das nicht“, schreibt Lahusen dazu in seinem Vorwort. Als 1945 gegen Ende des proklamierten tausendjährigen Dritten Reiches die staatliche Ordnung nur noch rudimentär funktionierte, sollte man davon ausgehen, dass durch Bombenangriffe auch auf Justizgebäude sowie den massenhaften Abzug von dem in der Justiz eingesetztem Personal auf allen Ebenen (von den höchsten Richtern bis zur Schreibkraft) es selbstverständlich in großen Teilen des Reiches und in den eroberten und annektierten Gebieten zu einem Justitium, also einem Stillstand der Rechtspflege kam. Weit gefehlt, es gab einen Bereich, der unverändert weiterzuarbeiten schien: die Justiz!
Zu welchen abstrusen Regelungen, Entwicklungen und Verfahrensabläufen es deswegen zwischen 1943 und 1948 kam, erläutert teils humorvoll, aber absolut umfassend Benjamin Lahusen in seinem
außergewöhnlichen Buch: »Der Dienstbetrieb ist nicht gestört. Die Deutschen und ihre Justiz 1943 – 1948«.
Benjamin Lahusen, Professor für Bürgerliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte an der Viadrina in Frankfurt/Oder, ist seit 2020 auch Geschäftsführer der Beratenden Kommission im Zusammenhang mit
der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz.
Nach einer Einleitung nähert sich Lahusen dem Thema in insgesamt sieben Kapiteln. Er hat dazu ca. 40 Archive in den verschiedensten Ländern durchforstet. Seine Erkenntnisse fußen somit auf einem
reichen Literaturfundus. „Das Recht durfte
den Krieg nicht stören, aber umgekehrt durfte auch der Krieg das Recht nicht zu sehr stören“, war die vorgegebene Leitlinie für die Justiz, so der Autor. De facto kam es auch nie zu einem
Justitium, der juristische Dienstbetrieb wurde mehr oder weniger ununterbrochen am Laufen gehalten, so gesehen wurde stets und ständig ein gewisser Grad an Normalität erhalten. Dies ist das Thema
des ersten Kapitels, in dem Lahusen aufzeigt, wie trotz Einbruch und Rückzug an allen Fronten der Gerichtsbetrieb aufrechterhalten wurde. Selbst als in den zahlreichen Bombennächten
Justizgebäuden dem Erdboden gleichgemacht wurden,
verhandelte und urteilte man weiter. Es wurden die Standorte der Gerichte verlegt, tonnenweise Akten und Mobiliar inklusive des die Dokumente verwaltenden Personals umgezogen, um unerwünschte
Unterbrechungen zu vermeiden. Der Autor
unterstreicht hier die jederzeitige Loyalität sowie das Pflichtbewusstsein des in der Justiz eingesetzten Personals auf allen Ebenen. Durch diesen somit weiterhin gesetzten rechtlichen Rahmen um
alle Weisungen und Maßnahmen, konnte erst der von Goebbels proklamierte totale Kriege um- und vor allem durchgesetzt werden.
Im zweiten Kapitel zeigt Lahusen wie in einem Drehbuch für ein Theaterstück anhand der fiktiven Stadt „Neustadt“, wie man sich den juristischen Dienstbetrieb in einer deutschen Kleinstadt gegen
Ende des Zweiten Weltkrieges vorzustellen hat. Anhand akribisch analysierter Aktenbestände beschreibt er eine Synthese verschiedenster Gerichte auf verschiedenen Ebenen, also anhand real so
stattgefundener Fällen und rekonstruiert so ein prototypisches Amtsgericht. Der Überfall auf Polen stellte das Deutsche Reich grundbuchrechtlich vor immensen Herausforderungen. Der Kampf der
Soldaten um Lebensraum im Osten galt es aktenmäßig nachzubereiten mit allem Sinn Deutscher Bürokratie und Improvisationskunst. „Das deutsche Grundbuch traf auf unbekannte Regionen“,
so Lahusen. Deswegen beschreibt er im folgenden Kapitel, Parzellierung des Todes, die grundbuchmäßige Erfassung von Auschwitz als Beispiel einer Art „bürokratischen Faktenschaffung“ in den
eroberten und besetzten Gebieten als eine Form der grundbuchrechtlichen Nachbereitung des Rassenkrieges. Dies erfolgte durch das zuständige Amtsgericht dort, was erst ein Jahr vor Kriegsende
durch den notariellen Vertrag zwischen der IG Farben, die ihre dortigen Investitionen juristisch abgesichert haben wollten, und dem Deutschen Reich protokolliert wurde. Erst jetzt war somit das
Konzentrationslager als Hort von Sklavenarbeitern und Massenmord ordnungsgemäß beurkundet.
Ein Paradebeispiel für einen Juristen im nationalsozialistischen Regime beschreibt Lahusen dann mit Hans Keutgen in Kapitel 4, bis zuletzt Richter am Sondergericht in Aachen. Pflichtbewusstsein,
Treue und Gehorsam für das Regime vereinigten sich bei ihm exemplarisch, war er doch als treuer „Parteisoldat“ Rechtsreferent in der Hitler-Jugend, SA sowie NSDAP. Wie viele seiner
Berufsgenossen, wurde er bereits am 15. August 1945, also unmittelbar nach Kriegsende, wieder als Richter zugelassen und am 29. Januar 1946 offiziell ernannt. Etwaigen Untersuchungen gegen ihn
verliefen schnell im Sande, konnte er doch nachweisen, lediglich ein Mitläufer im mörderischen System gewesen zu sein. Dies obwohl er nachweislich Todesurteile fällte.
„Auf der Flucht“ heißt das fünfte Kapitel und thematisiert die aufgrund der zurückgedrängten Wehrmacht notwendige Verlegung von Gerichtsbehörden in der Endphase des Krieges. Dachte man zunächst,
alles wäre nur „z.Zt.“, war spätestens mit Beginn der russischen Offensive in Ostpreußen am 12. Januar 1945 klar, dass der Verlust von Terrain für immer sein wird. Überrascht von der
Schnelligkeit des Vorstoßes, wurde aus „geordneter Rückführung“ bald pure Flucht. Deutlich wird hier, so der Autor, dass die vollständige Sicherung von Akten und Dokumenten aufgrund seines
Umfangs und damit schon allein schier aus Gewichtsgründen unmöglich schien. Trotzdem ging auch hier die Rettung von Papier vor der Rettung von Menschen. Um jedoch zu verhindern, dass es durch die
ständigen Verlagerungen zu einem Stillstand kam, wurden Sondergerichte etabliert, die mühsam versuchten, die Arbeit von Hunderten von Gerichten aufzufangen. Fortsetzung der Rechtspflege somit bis
zum bitteren Ende.
Im vorletzten Kapitel beschreibt Lahusen dann das Justitium als solches, was jedoch selbst in der Interimsphase zwischen der Kapitulation des deutschen Reiches und der Übernahme und Regelungen in
den Besatzungszonen keiner war. In einem Art Wettlauf sei es den Besatzungsmächten darum gegangen, schnellstmöglch die Arbeitsfähigkeit der Gerichte wiederherzustellen, egal wie! Dabei
unterstreicht er, dass in den französischen, britischen und amerikanischen Besatzungszone, ehemalige, NSDAP-treue Juristen als unverzichtbar für den Wiederaufbau einer demokratischen Legislative
galten, während man in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) alle mit der NSDAP in Verbindung gebrachten Juristen ihrer Posten enthob und durch Volksjuristen ersetzte.
Im letzten Kapitel „Die Abwicklung“ beschreibt der Autor die juristische Abwicklung des Krieges, was aber mangels eines Friedensvertrages völkerrechtlich nicht möglich war. Letztendlich blieben
zunächst nur ca. 50 Landgerichte und 550 Amtsgerichte übrig. Erst sieben Jahre nach dem Krieg einigten sich Bundestag und Bundesrat auf das „Zuständigkeitsergänzungsgesetz“ (Gesetz zur Ergänzung
von Zuständigkeiten auf den Gebieten des Bürgerlichen Rechts, des Handelsrechts und des Strafrechts) indem man nun juristisch den Spagat zwischen Vorbehaltsrechte der Alliierten und Ende des
Kriegszustandes schaffte. Hier schließt sich auch der Kreis, da dieses Gesetz in seiner geänderten Fassung aus dem April 2006, auch der Auslöser für dieses Buch war.
In Paragraf 245 der Zivilprozessordnung heißt es: „Hört infolge eines Krieges oder eines anderen Ereignisses die Tätigkeit des Gerichts auf, so wird für die Dauer dieses Zustandes das Verfahren
unterbrochen.“ Der juristische Dienstbetrieb kam in keiner Phase so richtig zum Stillstand, weder gegen Ende des Krieges bis zur Kapitulation noch in der Phase nach der Kapitulation und der
Etablierung der Besatzungszonen. Lahusen zitiert hier treffenderweise bereits aus einem Buch aus dem Jahre 1936, in dem es heißt: „Sind die Richter am Leben, geht das Recht seinen gewohnten Gang,
sind sie erst einmal tot, dann auch.“ Es findet sich immer jemand, egal welcher Qualifikation, der dann einspringt und Recht spricht. Allerdings kann von einer stabilen, geordneten
Rechtsordnung nicht die Rede sein, mal mangels Gebäude oder besser Amtssitz, mal mangels Personals, mal mangels Akten, die irgendwie verschollen gingen. Trotzdem wurde, auf welcher Basis auch
immer, Entscheidungen und Urteile gefällt, deren Vollstreckung durch die nicht vorhandene Exekutive erneut nur neue Fragen aufwarf. Selbst Aktenzeichen wurden fortgesetzt. Die Normalität des
juristischen Dienstbetriebes, die zwischen, unter und neben den Trümmern hervorblitzte, überstrahlte die finstere Gegenwart … So lässt sich die Kernbotschaft dieser Zeit von Lahusen am besten
zusammenfassen. Das Recht, so Lahusen, blendete den Krieg weitestgehend aus, es entfaltete sich stets weiter und verwandelte sich wie ein Chamäleon den äußeren Umständen geschuldet immer wieder
der Situation an, um nicht zum Ruhen zu kommen. Dies selbst dann, als ab 1944 nur noch unter 40 Prozent der Richterstellen besetzt waren. Ohne Akten, Personal, Gebäude und Gerichtsorten wurde
weiter Recht und Unrecht gesprochen. Es wurde weiter über Mörder, Verräter, Volkschädlinge „gerichtet“, um hinzurichten. Selbst einige Wochen nach der Kapitulation am 8. Mai 1945 um 23:01 Uhr,
wurden noch Urteil „Im Namen des Deutschen Volkes“ gefällt. Dies bot dem Justizpersonal die stete Illusion einer ungestörten Normalität im kollektiven Ausnahmezustand und erzeugte beim Autor auch
eine gewisse Heiterkeit.
Die Handhabung des Wiederaufbaus eines Justizwesens im besiegten Deutschland verlief gänzlich unterschiedlich im Westen, wo im Sinne eines stabilen Rechtsfriedens über 80 Prozent der Stellen mit
ehemaligen NSDAP-Mitgliedern besetzt wurden („altgediente Volljuristen“), im Vergleich zur SBZ, wo diese Quote gegen Null ging („neue Volksjuristen“). Die Normalität im Justizwesen des Dritten
Reiches wurde so in die Normalität der Nachkriegszeit im Westen transferiert.
In einem Regime, dass unterhalb von Hitler als Leitinstanz von mehreren Machtsäulen getragen wurde, die miteinander verzahnt waren und sich nicht selten bekämpften, die auch vielen Rivalitäten
und inneren Konflikten ausgesetzt war, passten die verqueren Logiken der Fortsetzung des Justizbetriebes perfekt. Trotz eines vor sich hinsiechenden Regimes und Auflösungserscheinungen an allen
Ecken und Enden wurde an Zuständigkeiten, Vorschriften, Abläufen festgehalten, so dass
das System so manches Unrechtbewusstsein verschluckte. So waren es vor allem neben Techniker, Ingenieure und Mediziner eben die Juristen, die einerseits vom Regime gebraucht wurden, aber im
Wissen um ihre Wichtigkeit auch unheimlich
profitierten – so wie später auch beim Wiederaufbau des sich am Boden befindlichen Deutschlands. Man verwaltete mit dem im nationalsozialistischen Regime üblichem Perfektionismus den eigenen
Untergang, sachlich, nüchtern, realitätsfern, so die auf den Punkt gebrachte Analyse Lahusens. Die Justiz war im System ein Vorbild an Dienstbeflissenheit, Hort der Ruhe sowie Garant der Ordnung
und damit ein Kontinuum für das Volk.
Auch in anderen Ländern gab es nationalistische Strömungen, aber die Nachwehen des Ersten Weltkriegs und das Trauma von Versailles radikalisierten die auch ökonomisch befeuerten Strömungen in
Deutschland im Besonderen und damit den
speziellen Charakter der NS-Diktatur. Gerade die im Justizwesen eingesetzten „Werkzeuge“ Hitlers waren Akademiker aus Familien höherer Schichten waren. Diese waren im Schatten der für jedermann
sichtbaren Schlägertrupps die eigentlichen
(administrativ wie exekutorisch) Stützen der Verbrechen. Diejenigen Verwaltungseliten, die aktiv ein mörderisches Regime unterstützten, waren paradoxer Weise auch dieselben, welche dann
mithalfen, eine Demokratie zu errichten. Die von den Alliierten und fast allen Parteien hingenommene Einbindung von Tätern in das nachkriegsgeschichtliche Bürgertum, neutralisiert deren Taten und
die immerwährende Belastung der Gesellschaft mit den Verbrechen des Regimes.
✔ Fazit: Lahusen präsentiert selbst für Geschichtsinteressierte grundsätzlich vieles Neues, das vorliegende Werk ist eine glänzende Analyse und zusammenfassende Darstellung seiner langjährigen Beschäftigung mit dem Justizwesen im nationalsozialistischen Regime. Dies alles in einem hervorragend zu lesenden, spannenden und damit fesselnden Schreibstil. Ohne durch inhaltliche Sprünge den Leser zu überfordern, überzeugt Lahusen mit einer Fülle an Informationen, seiner Analyse und Nachvollziehbarkeit seiner Argumentation und Thesen.
Andreas Pickel
★★★★★
5 von 5
© 2023 Andreas Pickel, Harald Kloth, Cover: Copyright © Verlag C.H. Beck
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Benjamin Lahusen: Der Dienstbetrieb ist nicht gestört *Hardcover bei amazon.de
*Kindle bei amazon.de
Colony
2016 - 2018
3 Staffeln, 36 Folgen, 1512 Minuten
Los Angeles in einer nahen Zukunft. Eine von außerirdischen Invasoren errichtete, riesige Mauer riegelt die Millionenstadt ab. Innerhalb der Barriere werden die Menschen von Soldaten und Drohnen ständig überwacht. Medikamente und Nahrungsmittel sind rationiert, private Fahrzeuge und Luxusartikel sind nur mehr einer Elite vorbehalten, die mit der Besatzung kollaborieren.
Inmitten dieses Alptraums kämpft Familie Bowman ums Überleben. Vater Will (Josh Holloway, bekannt aus »Lost«) arbeitet als Ex-Bundesagent mit den Besatzern zusammen. So hofft er, seinen verschwundenen Sohn Charlie wiederzufinden. Mutter Katie (Sarah Wayne Callies, bekannt aus »The Walking Dead«) kämpft im Widerstand zusammen mit dem ehemaligen Soldat Broussard (Tory Kittles, aus »True Detective«), verheimlicht dies aber vor ihrem Mann. Teenager-Sohn Bram (Alex Neustaedter) versucht die Mauer auf eigene Faust durch einen Tunnel zu überwinden, wird schließlich gefangengenommen und in ein Arbeitslager gesteckt.
Diese dramatische Science-Fiction-Serie der Showrunner Ryan J. Condal (»House of the Dragon«) und Carlton Cuse (»Lost«, »Jack Ryan«) macht sehr vieles richtig. Außerirdische oder deren überlegene Technologie wird - bis auf die omnipräsenten Drohnen - nur selten und fragmentarisch gezeigt. Erst sehr spät und wenig sieht man weitere Technologie wie Raumschiffe oder „Kampfläufer". Stattdessen sehen die Zuschauer (in den ersten zwei Serienstaffeln) eine menschliche Stadtgesellschaft im Niedergang. Die Menschen kollaborieren aus Furcht oder Versprechungen, ohne aber die wahre Ziele der Invasoren zu kennen.
Familie Bowman bildet die vielen Facetten dieser Besatzungsthematik perfekt ab: Kollaboration, Indoktrinierung, Verrat, Mord, Internierungslager oder Traumata. Interessanterweise würde diese packende Fernsehserie wohl ebenso ohne SciFi-Elemente funktionieren.
Die erfahrenen Hauptdarsteller Wayne Callies und Holloway sind glaubwürdig und stellen die Charaktere intensiv dar. Vor allem Mutter Katie wird zunehmend ambivalenter und als extrem widerstandsfähige Frau portraitiert. Die frühere »Prison Break«-Darstellerin darf hier eine äußerst starke Frau mimen, die stärkste Rolle dieser Serie.
Erst in der dritten und letzten Staffel wird L. A. als Handlungsort verlassen. Es geht zuerst in ein Widerstandslager in der Wäldern und dann in die „Vorzeigekolonie" Seattle, die natürlich ebenso ihre Geheimnisse birgt. Zudem ist ein großer Verlust zu bewältigen.
Im Science-Fiction-Genre gehört die Serie »Colony« zu den besseren Werken mit Thema Invasion. Im Gegensatz zu »Das Ding aus einer anderen Welt« (1951 und 1982) oder »Die Dämonischen« (1956) und »Die Körperfresser kommen« (1978) steht aber hier keine schleichende oder geheime Verwandlung der Menschen an. Stattdessen agieren die Invasoren brutal, öffentlich und mit Hilfe der Menschen. Ähnlich wie in »V: Die außerirdischen Besucher kommen« (1983) oder »Falling Skies« (2011-2015) muß sich die Zivilgesellschaft anpassen oder kämpfen. Wem das zuviel Politik und zu wenig Action ist, kann auch zum militaristischen »World Invasion: Battle Los Angeles« (2011) oder dem Zeitreisekracher »Edge of Tomorrow« (2014) greifen. Auch hier überfallen böse Aliens die Erde, wobei letzgenannter mit Tom Cruise und Emily Blunt in den Hauptrollen einen überaus netten Twist bietet.
Die drei Staffeln der TV-Serie sind sowohl als DVD, wie auch auf Blu-ray bei Pandastorm Pictures erschienen. Zusätzlich zu den Einzelstaffeln jeweils auch als Gesamtboxen mit 11 Discs und über 25 Stunden Spielzeit. Diese sind aber nur noch schwer erhältlich.
Fazit: Eine Familie zwischen Kollaboration und Widerstand. Für Thriller- und Spionage-Fans ein packendes Fest in drei Akten. Science-Fiction-Fans werden die unheilvolle Stimmung und Elemente rund um die Invasoren lieben.
Harald Kloth
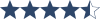
© 2023 Harald Kloth
Werbung | Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate Links. Kommt über einen solchen externen Link ein Einkauf zustande, wird der Betreiber dieser Website mit einer Provision beteiligt. Für Sie enstehen dabei keine Mehrkosten.
Colony - Die komplette Serie *DVDs bei amazon.de
*Blu-rays bei amazon.de
